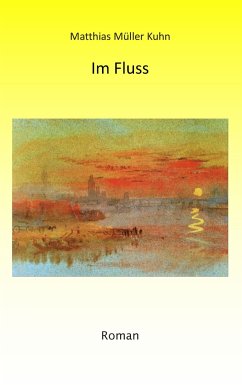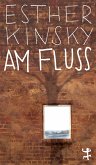In seinem dritten Essayband steigt der Lyriker José F. A. Oliver in die Flüsse seiner Sprachen. Er weiß, dass alles fließt, und dass dies immer auch Zuversicht bedeutet. Ausgespannt zwischen mindestens zwei Sprach- oder Sprechkulturen und den filigran skizzierten Visionen ins mögliche Zusammenleben einer sich immer wieder überraschend erneuernden Gesellschaft, fertigt er utopische Skizzen an, die in jedem Satz das Vergangene als Fährten in die Zukunft aufschimmern lassen. Ein Spurenfund, der das Heutige meint und eint und sich in dem, was war, vielstimmig kristallisiert. Worte bergen Orte. Orte lassen Worte mäandern. »W:orte«, wie sie José F. A. Oliver bisweilen bezeichnet. Sie lotet er hoffnungsfroh aus, sodass im mehrkulturellen Klang und seinen Rhythmen Bilder hörbar, Träume und Räume geschöpft werden, Rettungsinseln im Fluss aus Migrationsgeschichten, nomadisch unterwegs zu sich selbst, aber darum nicht weniger denjenigen zugewandt, die sich dieser verdichteten Kurzprosa annehmen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Gern liest Rezensentin Angelika Overath José F. A. Olivers Essay, der geprägt ist von den verschiedenen Sprachen, die das Leben des im Schwarzwald aufgewachsenen Sohns spanischer Eltern prägen: Andalusisch, Alemannisch, Deutsch und Spanisch. Besonders gut gefallen der Rezensentin die autobiografischen Passagen, die zum Beispiel an die Costa del Sol führen, zu den Großeltern, aber auch in den heimischen Schwarzwald, wo der junge Oliver viele Bücher mit sich trägt und einen geheimen Schreibtisch besitzt. Außerdem, so Overath, schreibt Oliver über Sprache, zerlegt einzelne Worte oder wechselt gleich ganz zur Form des Gedichts über. Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit prägt den Text, so Overath, der überhaupt der lyrische Ton Olivers gut gefallen zu haben scheint. Etwa wenn er über seinen Vater sagt: "Die Sardinen schienen nach Hause zu schwimmen und er hinterher."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

José F. Olivers Erkundung der eigenen Sprachspiele
José F. A. Oliver stellt in der deutschsprachigen Literatur eine singuläre Autorenpersönlichkeit dar. Als 1961 geborener Sohn spanischer Eltern, die im Jahr zuvor aus Andalusien nach Deutschland gezogen waren, wuchs er als ältestes von vier Kindern in Hausach im Schwarzwälder Kinzigtal auf. Das ist alemannisches Hoheitsgebiet. "Ich wurde in mehreren Sprachen geliebt", sagt Oliver und benennt das Wörter-Miteinander und -Ineinander seiner Kindheit aus Andalusisch und Alemannisch, zu dem später das schriftsprachliche Spanisch und Deutsch kamen.
Zentral in seinem Essay "In jeden Fluss mündet ein Meer" sind die Erinnerungen an die andalusischen Großeltern und Eltern, die seine Kindheit im Schwarzwald prägten. Zu ihr gehörten sommerliche Autofahrten an die Costa del Sol, den Sehnsuchts- und Heimwehort der Eltern. Für den Schwarzwaldbuben war das zunächst "Exil", musste er doch für die Ferien in der Fremde seine Fahrradausflüge durchs Kinzigtal - die Radtaschen voller Bücher - aufgeben und seinen heimlichen, selbst zusammengezimmerten Schreibtisch, versteckt "hinter de Holzbiige unterm Trippel", verlassen.
Oliver, der von seiner "Nomadenbiographie" spricht, ist stark verwurzelt im Schwarzwald, in Hausach, wo er vor mehr als zwanzig Jahren das Literaturfestival "LeseLenz" initiierte und seither organisiert. Immer wieder hat er über Hausach als sein "andalusisches Schwarzwalddorf" geschrieben. Und wenn er den chilenischen Schriftsteller Luís Sepúlveda zitiert - "Letzten Endes war er wie einer von ihnen, aber er war nicht einer der Ihren" -, dann könnte einem auch George Tabori einfallen, der betonte, dass er "keine Heimat habe", dass er ein Fremder sei: "und das meine ich nicht pathetisch, sondern als gute Sache. Weil ein Schriftsteller, nach meinem Geschmack, muss ein Fremder sein." Im Fremdsein steckt poetisches Potential. Der Fremde sieht, hört, schmeckt, fühlt, was ein "nur" Einheimischer oft nicht (mehr) wahrnimmt. Das Fremdsein schenkt den staunenden Abstand, der Literatur im guten Fall begleitet.
Olivers Essay hat oft einen lyrischen Ton, zieht sich manchmal ganz in das Gedicht zurück. Seine stärksten Passagen sind weniger die sprachphilosophischen Überlegungen oder seine (als könnten sie Bedeutungsvolles erzwingen) Spielereien, in denen er Wörter bricht ("Beg:reifen", oder "W:erden" oder "T:raum" oder "W:ort"), sondern die autobiographischen Felder, auf die er mitnimmt, erlebnishaft, erinnerungsgesättigt. Hier findet sich eine wunderbare Hommage an den Großvater, den "Meermann", der den Schwarzwaldbuben in seinen andalusischen Ferien nachts weckte und zum Fischen hinausnahm und der sagen konnte: "Hörst du, wie still das Licht ist." Die "Großmutterpflanze" taucht auf, die kein Deutsch spricht und mit dem Knaben, der schlecht Spanisch kann, ein Wir zwischen den Sprachen bildet: "Ein immerfremdeln-/der Plural". Und da kommt im Erinnern ein Vater zurück, der, wenn er endlich wieder an der vermissten Costa del Sol sein kann, die gegrillten Sardinen vom Bambusstecken abzieht und verschlingt. "Vater war mit leuchtenden und immer größer werdenden Augen in einer anderen Welt. Nein! Meer noch: Er wurde zu einer anderen Welt. Je mehr der kleinen, olivendunkel schimmernden Urlaubsfischchen in ihm abtauchten." Essen ist (in gut katholischer Tradition, in der Olivers Kindheit stand) auch Gott-Essen. So sind die Sardinen, die der Vater "wie in Trance" sich in den Mund steckt, fast ein "religiöser Akt demutsvoller Hingabe und Kommunion". Und: "Die Sardinen schienen nach Hause zu schwimmen und er hinterher."
Und dann sitzt die Familie, wieder bei verschneiten Tannen, am Silvesterabend 1968 vor dem ersten Schwarz-Weiß-Fernsehgerät (Schaub-Lorenz) und wartet, bis der Zeiger der Fernsehuhr auf die zwölf springt. Alle haben ein von der Mutter gefaltetes Papierschiffchen voller Trauben vor sich, und der Brauch will es, dass sie, während die Glocken zwölfmal schlagen, zwölf Trauben hinunterschlucken, eine Traube für jeden Monat des kommenden Jahrs, ohne sie zu zerbeißen. Das bringe Glück. Aber keiner schaffte es so recht, nicht einmal der Vater, der schummelte. Wunderbar die Bilder seiner Mutter, die andalusische Speisen in die Kinzigtaler Küche bringt und "an den winterlichen Schlachttagen im Schwarzwald s Hirnle von dere Sau für sich und ihren ondalusische Eierdotsche am Abend reserviert".
Der Gedanke an die menschliche Gast-Endlichkeit auf Erden durchzieht den Band. Er beginnt mit dem Elfjährigen, der in Deutschland anrufen muss, "um den schlichten Satz zu sagen: 'Großvater ist tot!'" - ein schlichter Satz kann monströs sein, nicht nur für ein Kind -, und endet mit der Erinnerung an die letzten Tage einer krebskranken Freundin, die ihn das Loslassen lehrte, und dem Gedenken an die "Trinkerin" Hertha, die Tisch und Stuhl und Weinflasche beim Namen ihres verstorbenen Mannes Hannes rief und das Vergissmeinnicht "Trostjasmin" nannte.
Im Alemannischen klingt er weich, "de Dod". Im Spanischen ist er weiblich (la muerte) und trägt eine Mantilla, ein schwarzes Schleiertuch, im Deutschen beginnt er mit einem harten T und schwingt die Sense. Bilder diffundieren, stellen sich infrage und öffnen sich für neue Fragen, neue Bilder. Der Tod ist dem Menschen eingeschrieben in die schreibende Hand. Als das Kind die Mutter einmal fragte, was das Wort "Sicherheit" bedeute, zeichnete sie in seinen beiden Handinnenflächen das M nach. Und erklärte, dass die Sicherheit ausgespannt sei zwischen "mamá", der Verlässlichkeit seiner Geburt, und "muerte", der Bestimmtheit seines Todes.
"In jeden Fluss mündet ein Meer" ist auch das Buch eines Autors, der, vielleicht zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit, spürt, dass sein Lebenshorizont absehbar ist, und der sich fragt, "ob mir der Rückzug ins Eigene gelingen wird". Der Fluchtweg wäre wohl immer das Gedicht. ANGELIKA OVERATH
José F. A. Oliver: "In jeden Fluss mündet ein Meer".
Matthes & Seitz, Berlin 2023. 127 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main