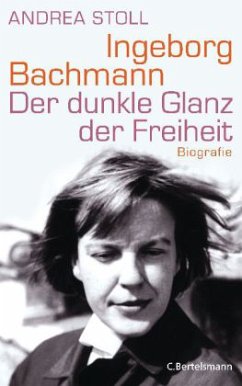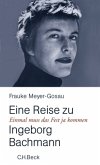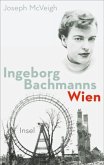Die große Biografie einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen
Seit dem tragischen Tod Ingeborg Bachmanns am 17. Oktober 1973 in Rom überlagern Mythen und Legenden das Leben der gefeierten Schriftstellerin. Doch wer war die Frau hinter der strahlenden Ikone, die ihr Privatleben eisern zu verteidigen wusste und der nur wenige Freunde wirklich nahekamen?
In ihrer Biografie zum 40. Todestag macht Andrea Stoll das Drama einer Frau und Künstlerin lebendig, die ihr Schreiben nie nur als Berufung, sondern immer auch als Zwang, Obsession, Verdammnis und Strafe empfunden hat. Weltbürgerin und Heimatsuchende in einem, über Jahre gefangen in einem Dickicht hochkomplizierter Liebesbeziehungen und Freundschaften, allen voran zu Paul Celan, Hans Werner Henze und Max Frisch, hat Bachmann doch immer auch um ihre persönliche Freiheit gerungen und ihre literarischen Ziele kompromisslos verteidigt. Wie sehr Bachmann ihrer Zeit voraus war und welchen Preis sie dafür bezahlen musste, führt uns diese Biografie in eindrucksvoller Weise vor Augen.
Seit dem tragischen Tod Ingeborg Bachmanns am 17. Oktober 1973 in Rom überlagern Mythen und Legenden das Leben der gefeierten Schriftstellerin. Doch wer war die Frau hinter der strahlenden Ikone, die ihr Privatleben eisern zu verteidigen wusste und der nur wenige Freunde wirklich nahekamen?
In ihrer Biografie zum 40. Todestag macht Andrea Stoll das Drama einer Frau und Künstlerin lebendig, die ihr Schreiben nie nur als Berufung, sondern immer auch als Zwang, Obsession, Verdammnis und Strafe empfunden hat. Weltbürgerin und Heimatsuchende in einem, über Jahre gefangen in einem Dickicht hochkomplizierter Liebesbeziehungen und Freundschaften, allen voran zu Paul Celan, Hans Werner Henze und Max Frisch, hat Bachmann doch immer auch um ihre persönliche Freiheit gerungen und ihre literarischen Ziele kompromisslos verteidigt. Wie sehr Bachmann ihrer Zeit voraus war und welchen Preis sie dafür bezahlen musste, führt uns diese Biografie in eindrucksvoller Weise vor Augen.

Wie oft will man die ewig gleichen Bachmann-Klischees noch wiederholen? Das Leben dieser Dichterin muss viel interessanter gewesen sein, als es sich ihre Biographin träumen lassen kann
Leute sprechen über Ingeborg Bachmann, und sie werden sofort toternst. Sie ist vielen Menschen eine Heilige, sie ist das moderne Autorinnenbeispiel schlechthin, eines, das an sich und der Kunst zeitlebens gelitten und das sich vollständig dafür verausgabt hat, bis es schließlich daran gestorben ist.
Darüber gibt es nichts zu lachen. Und dennoch: Es kann nicht sein, dass ein Mensch lebt und dabei von morgens bis abends, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr bis zu seinem Tod nur dieser eine Mensch ist, der elfenhaft an der Kunst leidet, zittert und darüber verrückt wird, aber in genau jenes Künstlerbild sind die Menschen hierzulande verliebt, weswegen sie es unausgesetzt reproduzieren, und es ist genau jene Ernsthaftigkeit-und-Trauer-Verpflichtungsklausel, welche man in der Universität, in den Feuilletons und beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt unterschreiben muss, bevor man zum wirklich sehr besonderen Werk Ingeborg Bachmanns durchgelassen wird, welche es kaputt und unzugänglich und monströs macht.
Nun ist, anlässlich des 40. Todestages der Autorin, eine neue Biographie erschienen, deren Verfasserin Andrea Stoll es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine "vielschichtig fundierte Biographie Bachmanns" vorzulegen, wobei ihr Anspruch war, sich von der "Vorstellung einer einzigen zielführenden Perspektive" zu verabschieden und stattdessen die "Vielstimmigkeit des biographischen Erzählens" sprechen zu lassen. Andrea Stoll hat mit den beiden jüngeren Geschwistern und Freunden Bachmanns gesprochen, daher die "Vielstimmigkeit", und diese Vielstimmigkeit meint wohl, dass unterschiedliche Perspektiven auf Ingeborg Bachmann in den Text einfließen, um ein möglichst komplexes Bild zu zeichnen. Es geht darum, mehr, umfassender und vielleicht anders über den Menschen Ingeborg Bachmann zu erzählen.
Inwiefern also trifft man beim Lesen eine andere Frau als jene verordnete Künstlerperson? Man trifft sie, etwa, wenn man liest, wie intensiv und liebevoll der Kontakt war, welchen Bachmann zu ihrer wohl tatsächlich heilen Familie pflegte. Regelmäßig schrieb sie Briefe nach Hause, nach Klagenfurt, wohin sie sich zurückzog, wenn sie sich von den Strapazen ihres freien Autorendaseins erholen wollte und ihre Ruhe brauchte. Insbesondere zu ihrem Vater Heinz Bachmann hatte sie eine enge Beziehung, er soll in ihr die Liebe zur Literatur geweckt haben. Ingeborg Bachmann selbst schrieb über ihre Kinderzeit, dass man ihre Erziehung insgesamt als "vorbildlich" bezeichnen könne: "der Mangel an Luxus, aber nicht an Freude, nie ein ordinäres Wort, fast keine Spielsachen, keine Verwöhnung, keine Hilfe in Schuldingen, keine Beachtung der Noten". Die kleine Schwester von Ingeborg Bachmann, Isolde Moser, stand ihr ebenfalls sehr nahe, und sie bekam, anders als Ingeborg Bachmann, viele Kinder, welchen diese dann, sofern sie Geld hatte, schicke Kleider schenkte. Und: Ingeborg Bachmann soll Sehnsucht nach eigenen Kindern gehabt haben. Das zumindest haben "Freunde und Familie" bei ihr "verspürt". Aber: "Ihr Leben war unbehaust, wo hätte da ein Kind Platz finden können?" Dass irgendetwas an Ingeborg Bachmann auch heil gewesen sein könnte, habe ich bislang nicht für möglich gehalten (wenngleich das Heile nur so lange dauert, bis der Krieg kommt, ihr Vater NSDAP-Mitglied und Klagenfurt zerstört wird), aber es kommt noch heiler, noch toller: Sie soll sehr gut darin gewesen sein, Anekdoten unterhaltsam zu erzählen, und bisweilen, so bezeugten Freunde, genoss sie es sogar, sich auf Festen in der vornehmen Gesellschaft Roms oberflächlich zu unterhalten. Das ist so erleichternd! Und: "Haushalterisches Denken und Planen blieb ihr völlig fremd, was überwog, war die Freude am Augenblick, der Genuss im Hier und Jetzt." Sie bevorzugte Schuhwerk von Bruno Magli und liebte überhaupt schöne Kleider, was man auf den Fotos, welche in der Biographie abgebildet sind, sehen kann. Da strahlt sie mitunter so stark und schön, dass man ganz traurig wird, weil es nicht gut ausgeht.
1961 zieht sie mit Max Frisch in eine gemeinsame Wohnung. Zweistöckig, Marmorböden und: Buchattrappen. Die beiden Schriftsteller bewohnten eine Wohnung, in der Buchrücken herumstanden, in denen angeblich Baudelaire drin sein sollte, aber es war kein Baudelaire dahinter - was, wenngleich bekannt, sehr lustig ist, und bestimmt hatte das Paar auch ein bisschen Spaß. Und gleichzeitig ist es so traurig, genauso wie die fünfunddreißig Rosen, welche in Bachmanns Krankenhauszimmer standen, nachdem sie zusammengebrochen war, weil Frisch sie für eine jüngere Frau verlassen hatte. Als der sie dann im Krankenhaus besuchte, erwähnte sie einen Verehrer, der ihr regelmäßig Blumen schicke. Die fünfunddreißig Rosen aber hatte sie sich selbst geschickt, um Frisch eifersüchtig zu machen.
Und wenn man all diese kleinen Geschichten liest, dann lebt diese immer wieder als Dichter-Elfe, als Femme de lettres, als weinendes Rehkitz mit genialen Einfällen beschriebene Frau ein bisschen, dann bekommt man ein Gefühl für sie und glaubt, dass sie vielleicht an manchen Tagen ganz ordinär überlegt hat, was sie anziehen soll, bevor sie sich etwas zu essen kauft.
Leider war es das dann auch mit dem Treffen dieser anderen Frau, die sich bei 336 Seiten Buch doch sehr gut versteckt. Dabei ist die Biographie absolut supersorgfältig und gewissenhaft verfasst, und die Autorin hat sich die größte Mühe gegeben. Wenn man damit in einem literaturwissenschaftlichen Seminar auftaucht, macht man mit Sicherheit nichts falsch, und genauso liest es sich auch: ermüdend, brav. Universitätssprache mit so ein paar "lockeren" Sätzen dazwischen ("last but not least", oft, zu oft, was haben die Lektoren gemacht? Wo waren sie? Auch häufigst verwendet: Ingeborg Bachmann ließ sich nicht "in die Karten" schauen oder gucken). Kein Risiko, keine These, ich verstehe es einfach nicht, es ist mir schleierhaft! Wozu dann die ganze große Arbeit? Und solche Sätze: "Der für Süditalien unerwartete Kälteeinbruch inspirierte sie zu einer lyrischen Form, in der die Ausgesetztheit ihrer modernen weiblichen Existenz mit poetischen Bildern von archaischer Kraft verschmilzt." Eben jene Ausgesetztheit der modernen Frau, die Ausgesetztheit der Ingeborg Bachmann ist es auch, welche anhand ihrer biographischen Daten, ihrer Liebesbeziehungen, Veröffentlichungen und Ortswechsel erzählt wird. Klagenfurt, Wien, Gruppe 47, Paul Celan, Reisen, immer wieder Reisen, Hans Werner Henze, Rom, Pause, Klagenfurt, Berlin, keine Ruhe, Max Frisch, Rom, Tod.
Die Biographie heißt "Der dunkle Glanz der Freiheit" und legt ihren Schwerpunkt auf Bachmanns freie Autorenexistenz als Frau, was insofern gut und lesenswert ist, als häufig davon ausgegangen wird, Schriftstellerinnen seien eben frei, also ohne feste Anstellung, die müssten dafür nichts weiter tun, obwohl das Freiwerden und Freisein in Wahrheit der größte Krampf ist.
Es geht dann aber, wie angedeutet, nicht so gut weiter: "Wenn wir heute nach den Bedingungen von Bachmanns Autorenexistenz fragen, so müssen wir den Besonderheiten nachgehen, die eine freie Autorenexistenz in den 50er- und 60er-Jahren für eine Frau bereithielt, die ihre Weiblichkeit nicht verstecken wollte, die sich aber mit jedem Schritt im Dickicht der damals noch festgeschriebenen Geschlechterrollen behaupten musste", schreibt Andrea Stoll auf den ersten Seiten und verspricht somit, sich mit einem absolut interessanten Thema zu befassen (ganz abgesehen davon, dass es überhaupt nicht sicher ist, dass diese Geschlechterrollen heute nicht mehr festgeschrieben sind). Aber es wird einfach nicht interessant. Bestimmt liegt das auch an der vorsichtigen Erzählweise, den germanistischen Wörtern - aber es liegt ebenso daran, dass sich Andrea Stoll an den biographischen Stationen entlanghangelt, ohne - zumindest die Fragen der weiblichen Existenz als Autorin betreffend - in die Tiefe zu gehen, oder genauer: danach zu fragen.
Es ist im Gegenteil so, dass das Stereotyp der Frau als Opfer, als Ausgelieferte, Wehrlose ununterbrochen wiederholt wird, und zwar unhinterfragt: das "existenzielle Ausgeliefertsein der weiblichen Stimme", die Frau, welche mit dem Künstlerdasein geschlagen ist, für die es keinen Schutz gibt, die meist unter Tränen vorliest und dabei ihre Manuskriptblätter fallen lässt, die seit jeher ahnte, dass sie ihr künstlerisches Auserwähltsein teuer zu stehen kommen würde, die Schwache, die Erschöpfte, also kurz: die total Passive. Dennoch betont Andrea Stoll Bachmanns Geschick beim Erreichen ihrer Ziele und ihren unbeugsamen Willen. Beides, das Passive und der Willen, müssen kein Widerspruch sein, sie gehören wahrscheinlich sogar absolut zusammen, insbesondere in einer Zeit, in der sich das Rollenverhalten ganz langsam zu ändern begann. Aber genau das wird nicht reflektiert, auch und insbesondere nicht in Bezug auf Bachmanns Bewusstsein ihres Rollenverhaltens. Woher kam denn ihr auffällig starkes Gefühl des Ausgeliefertseins, der Schutzlosigkeit? Brauchen alle Menschen Schutz, oder nur Frauen? Nur Schriftstellerinnen oder auch Schriftsteller?
In Stolls Biographie von Bachmann jedenfalls funktioniert es so: Bachmann liest vor der Gruppe 47 einen Text vor. Sie haucht, sie weint, die Männer eilen herbei, um ihr zu helfen. Und dabei handelt es sich für Stoll nicht um ein rollentypisches Häschen-Verhalten (was ja nicht schlimm wäre), sondern um eine bewusst gewählte Inszenierung. An anderer Stelle ist Bachmann dann wieder das Opfer des eigenen Geschlechts und ihrer Begabung, das schließlich traurig scheitert, womit der Ernsthaftigkeit-und-Trauer-Verpflichtungspakt ein weiteres Mal geschlossen wäre, und das ist nicht neu, nicht frei, nicht unverstellt, das ist ein ehrfürchtiges Bachmann-Verehrungsbuch, von denen die ganze Bachmann-Welt voll steht. Beim Lesen denkt man, man folge einer Lehrerin, die ihrer besten Schülerin ein sehr gutes Zeugnis ausstellen will: Die Männer Celan, Henze und Frisch kommen immer ein bisschen schlechter weg als Bachmann, die gut und heilig erstrahlt. Warum? Kann nicht darüber mal jemand ein Buch schreiben?
ANTONIA BAUM
Andrea Stoll: "Ingeborg Bachmann. Der dunkle Glanz der Freiheit". C. Bertelsmann, 380 Seiten, 22,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Beatrice von Matt weiß Andrea Stolls "reichhaltige" Biografie über Ingeborg Bachmann zu schätzen. Sie hebt hervor, dass Stoll Einblick in bislang unbekannte Dokumente nehmen konnte. Dadurch gelingt es der Autorin ihres Erachtens überzeugend statt nur den "Mythos Bachmann" zu wiederholen in weiten Strecken das Bild eines "widersprüchlichen Menschen" zu zeichnen. Besonders lobt sie die ausführliche Behandlung von Bachmanns Kindheit. Kritisch äußert sie sich dagegen über Stolls Schilderung des Verhältnisses von Bachmann und Max Frisch. Hier kommt die Rezensentin nicht umhin, der Autorin grobe Unkenntnisse zu attestieren" die zu einem verzerrten Bild des Schweizer Schriftstellers führen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH