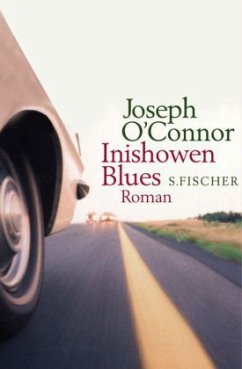In diesem Roman des jungen irischen Autors Joseph O'Connor kreuzen sich die Wege dreier ganz unterschiedlicher Menschen: da ist der 43jährige Polizist Martin Aitkens, dessen Welt in Scherben liegt, dann der erfolgreiche New Yorker Chirurg Milton Amery, dessen Privatleben alles andere als in Ordnung ist, und schließlich Ellen Donelly, die nach Irland reist, um das Rätsel um ihre Herkunft zu lösen und die am Ende diese drei Lebensläufe miteinander verknüpft.

Drüben auf den Hügeln: Joseph O'Connors irische Ballade
Auf den ersten Blick scheint der Roman "Inishowen Blues" des 1963 geborenen Iren Joseph O'Connor in mancher Hinsicht vor allem Lesererwartungen zu bestätigen: Ja, viele Nordamerikaner, jüngere wie ältere, führen eine derart entfremdete Alltagsexistenz als reizüberflutete, abgestumpfte Nervenbündel, daß sie einem leid tun können; jawohl, die Iren im Süden wie im Norden der Grünen Insel leben mit (und zum Teil auch recht passabel von) einer vertrackten, historisch bedingten kollektiven Gefühlslage, die sie zu unergründlichen europäischen Exoten macht.
Wer sich mit ihnen näher einläßt - und sei es nur, um Ahnenforschung zu betreiben -, gerät alsbald in die Versuchung, sie über den Weg zu einem gedeihlichen Zusammenleben belehren zu wollen, was ihnen dann alles andere als recht ist. Oder man nimmt Irland und die Iren von vornherein nicht ernst und betrachtet sie aus abwehrender Distanz: "All diese Düsternis, dieses Beckettsche Nichts, die entsetzliche Bedienung in den talgstinkenden Restaurants, die verblüffenden Zahnprobleme der Einheimischen, ihre schwerfällige Art zu sprechen, ihre rundheraus krankhafte Fixierung auf den Tod und längst Vergangenes, die monotone Traurigkeit ihrer endlosen Lieder. (. . .) Gab es noch ein anderes Land, das so bewehrt und so durch und durch und rettungslos kriegerisch war?"
Der so sinniert, ist Schönheitschirurg mit Praxis in New York; sein Name lautet Dr. Milton Longfellow Amery, weil ein Familientick seinen Vorfahren befahl, Kinder nach berühmten Dichtern zu benennen. Seine Ehefrau Ellen, Ende der vierziger Jahre unehelich in Irland geboren (als so etwas dort noch als schwerstmögliche Schande galt) und nach Amerika zur Adoption freigegeben, wird von Amery mit einer jungen Dame betrogen, die in etwa so alt ist wie seine Tochter, eine Yale-Studentin im Anfangsjahr, und der er ein Schmuckstück im Wert von fünfzehntausend Dollar zu Weihnachten schenken will.
Da die Gespielin das Geschenk nicht annehmen mag - aus Angst vor ihren Eltern, wie sie vorgibt; aber in Wirklichkeit, weil sie unangenehme Fragen ihres Verlobten befürchtet -, gibt Amery später praktischerweise vor, er habe die Brillanten von vornherein als Präsent für seine Ehefrau erworben. Über den Kaufpreis tröstet er sich wie folgt hinweg: "Er sollte nicht Milton Longfellow Amery heißen, wenn er nicht eine klimakterische Gesellschaftslöwin unters Messer bekäme, der er eine fünfzehntausend Dollar schwere Zellulitis aus dem Glutaeus maximus kratzen konnte."
Kein Wunder, sollte man meinen, daß einem solchen Zyniker eine sensible, moralisch empfindende Ehefrau einfach davonläuft. Ellen Amery, eine Schullehrerin mit dem Mädchennamen Donnelly, hat schon seit ungefähr zehn Jahren versucht, nähere Auskunft über die Umstände ihrer Geburt und die Identität ihrer Mutter einzuholen. In New York hat sie sich zusammen mit Gutmenschen, die von ihrem Mann verabscheut werden, an allerlei weltverbesserischen Aktivitäten beteiligt und zuletzt immer öfter Irland besucht.
Dort, in Dublin, entspinnt sich der zunächst andere Handlungsstrang der Geschichte. Auch dessen Träger, der Polizist Martin Aitken, führt die Initiale M. A. im Namen. Seine Ex-Frau Valerie, mit der er eine "selbstzerstörerische Ehe" führte, hat sich längst "bekloppten New-Age-Freunden" zugewandt und waltet als "Medium". Seit seiner Degradierung wegen eines im Dienst begangenen Tötungsdelikts und seiner Scheidung - beides verknüpft mit dem Umstand, daß sein neunjähriger Sohn bei einem möglicherweise vorsätzlich herbeigeführten Verkehrsunfall ums Leben kam - scheint Aitken langsam auf die schiefe Bahn zu geraten und zu verwahrlosen. In seiner Bleibe entdeckt er am Weihnachtsmorgen, dem ersten von ein paar Urlaubstagen, eine "rostfarbene Pilzkolonie, die rings um das Sofabein aus dem Teppich" sprießt.
Aitkens Schicksalsweg kreuzt sich mit dem von Ellen Amery. Während sie von dem Wunsch beseelt ist, endlich ihre leibliche Mutter aufzuspüren, verspürt er Scham angesichts der Tatsache, daß er nie das Grab seines Sohnes besucht hat, das zufällig ebenfalls in der Nähe des nördlichsten Punktes der Insel, in Inishowen, liegt, weil seine Ex-Ehefrau aus dieser Gegend stammt. Beide machen sich zu einer beschwerlichen, aufhaltsamen Autofahrt in den Norden auf - hier die eher verwöhnte Amerikanerin, die eine tödliche Krankheit in sich trägt und nicht nur wegen ihrer ungeklärten Herkunft, sondern wohl auch wegen eines gewissen Ennui zum bisweilen anstrengenden Irland-Fan geworden ist; dort der mitunter schwierige Aitken, der über dem Tod seines Sohnes beinahe zum schweren Trinker geworden wäre. Als gegen Ende der Handlung auch noch Ellens Ehemann mitsamt Kindern und einem übergeschnappten reichen Freund per Flugzeug eintrifft, gerät die Handlung an einen Punkt, an dem sie ähnlich zu implodieren scheint wie die Lebensbeziehungen der Beteiligten.
Klischees, auch solche, die von den Vereinigten Staaten oder Irland handeln, verdanken ihren Status und ihre Beliebtheit vor allem ihrer Eigenschaft, ziemlich oft zutreffend zu sein. Deshalb kann man ebenso belustigt wie bekümmert von den Familien-Tisch-Szenen im Hause Amery lesen und sich erinnern, ähnliches, wenngleich in weniger zugespitzter Form, in der Neuen Welt selber erlebt zu haben. Und deshalb hat man einige der irischen Balladensingsänge, deren Texte im Roman ausgiebig zitiert werden, beinahe im Ohr und wundert sich kaum noch, wenn ab und zu angedeutet wird, wie sich sentimentale Saufbolde ohne Übergang in rücksichtslose Brutalos verwandeln können.
Mag sein, daß O'Connor in dieses Buch in bester Absicht etwas viel hineingepackt hat: Ehekrisen, Kriminalfälle, irische Zeitgeschichte, Kulturkritik, Identitätsfindung - und das alles noch angereichert durch burleske, temporeiche Einlagen, die einer Filmkomödie alle Ehre machen würden. Aber damit steht er in bester Geschichtenerzählertradition, und so wimmelt es in diesem Roman auch von Anspielungen auf Helden der irischen Literatur, von Swift über Wilde, Yeats und Joyce bis Behan. Hinzu kommt, daß O'Connors Beobachtungs- und Formulierungsgabe frisch und unverbraucht wirkt: Wer zum Beispiel wissen will, was die Einsteinsche Relativitätstheorie für Verwandtschaftsverhältnisse bedeutet, was ein New Yorker Polizeipferd mit einem alternden Rockstar verbindet, was Gott und das Finanzamt gemeinsam haben, weshalb dem Wort "Talgdrüse" etwas Faszinierendes eignen kann und wieso "Warten auf Godot" vielleicht sogar als "Dokumentarstück über die Polizeiarbeit" gedacht war, der wird mit den Antworten auf diese Fragen gut bedient und insgesamt bestens unterhalten. Metaphysische Tröstung oder vollständige Aufklärung über die Tiefen und Untiefen der irischen beziehungsweise amerikanischen Seele wird man, und das ist letzten Endes wohltuend, vergebens suchen.
WOLFGANG STEUHL.
Joseph O'Connor: "Inishowen Blues". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Esther Kinsky. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2001. 478 S., geb., 20,40 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Auf den ersten Blick erscheint Bruno von Lutz der neue Roman O'Connors ziemlich konstruiert. Dennoch kommt er schließlich zu einem positiven Gesamturteil. Dies habe das Buch seiner "Mischung aus spannenden Thriller, literarischem Road-Movie und psychologischer Studie" zu verdanken, begründet er. Es hebe sich "wohltuend vom ubiquitären Grün der Irishness ab", fügt er an. Der 1963 geborene irische Autor, der in vielen literarischen Bereichen erfolgreich ist, thematisiere in seinem neuen Buch zum Beispiel die in Irland übliche Praxis, uneheliche Kinder in die USA zur Adoption freizugeben. Die sich hinter dieser Praxis verbergende Doppelmoral ist wohl nur ein Beispiel für ein geschöntes Bild von Irland, dass "wir zu kennen glauben", das aber, wie Lutz versichert, nur unter Ausschluss der eigentlichen, einer harschen Realität stattfinden" könne, was O'Connor in seinen Texte vermittelt . Aber auch die amerikanische Gesellschaft bekommt in diesem Roman ihr Fett ab, und diesen "Transatlanische Spagat" findet der Rezensent überzeugend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH