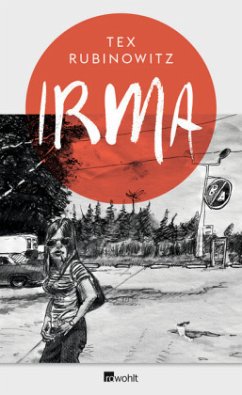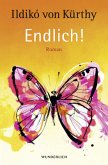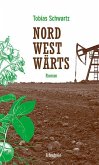Eine Freundschaftsanfrage per Facebook. Sie kommt von Irma. Die hat der Erzähler zuletzt vor 30 Jahren gesehen, als er mit ihr in Wien Wohnung und Bett teilte. Und alles begann und endete mit einem Zettel auf dem Küchentisch. Derart angestoßen, beginnt er sich zu erinnern: An die reichlich dysfunktionale Beziehung zweier junger Menschen, die nicht wissen, ob sie in Gefühlsdingen besonders aufrichtig oder einfach nur bindungsunfähig sind. An frühere Stationen seines Lebens, erotische Suchbewegungen, Niederlagen anderer Art, Missbrauchserfahrungen, Reisen in die Welt hinaus bis nach China.
Der Autor hat zu seinem Text Bilder gesammelt, alte Plattencover, Fotos, Werbepostkarten. Das kennt man seit W. G. Sebald von vielen "recherchierend" vorgehenden literarischen Werken. Rubinowitz stellt aber diese Form der Beglaubigung gleich wieder in Frage, indem er die Bilder von dem befreundeten Künstler Max Müller nachzeichnen lässt.
Dies ist ein ganz und gar eigensinniger, sprunghafter, komischer, sehr unterhaltsamer und zugleich verstörender Versuch über Vergänglichkeit und Erinnerung, über das, was zurückschaut, wenn man autobiographisch hinter sich blickt, und über das, was dabei herauskommt, wenn man sich anschickt, aus der eigenen Biographie Literatur zu machen.
Der Autor hat zu seinem Text Bilder gesammelt, alte Plattencover, Fotos, Werbepostkarten. Das kennt man seit W. G. Sebald von vielen "recherchierend" vorgehenden literarischen Werken. Rubinowitz stellt aber diese Form der Beglaubigung gleich wieder in Frage, indem er die Bilder von dem befreundeten Künstler Max Müller nachzeichnen lässt.
Dies ist ein ganz und gar eigensinniger, sprunghafter, komischer, sehr unterhaltsamer und zugleich verstörender Versuch über Vergänglichkeit und Erinnerung, über das, was zurückschaut, wenn man autobiographisch hinter sich blickt, und über das, was dabei herauskommt, wenn man sich anschickt, aus der eigenen Biographie Literatur zu machen.

Popkulturell dick eingepackte Lebensläufe: Eine literarische Playlist des Bachmann-Preisträgers Tex Rubinowitz
Er ist Mitte fünfzig und klingt wie zwanzig - oder so, wie wir mit zwanzig klangen, zumindest diejenigen von uns, die meinten, sie wüssten, wo es langgeht, und das besser als alle anderen. Der Zeichner, Musiker und Schriftsteller Tex Rubinowitz gewann im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis mit einem Text, der genau diesen postpubertären, präpotenten Sound hat, in dem selbst, nein, gerade jede Peinlichkeit mit dem Pomp eines selbstironischen und schier popikonischen Tuschs daherkommt. Nun hat der Preisträger aus der flotten Kurzprosa ein flottes Buch von zweihundertvierzig Seiten gemacht.
Dass es "Irma" heißt, nach der Freundin, die der Ich-Erzähler vor dreißig Jahren für ein paar Monate hatte, ist der Tatsache geschuldet, dass das Buch mit den Irma-Passagen beginnt - jenen Passagen also, die 2014 die Bachmann-Jury in der dritten Stichwahl überzeugten. Im Grunde aber geht es in "Irma" weniger um Irma oder die Liebe als um einen intellektuell und popkulturell dick abgefederten Schweinsgalopp durch eine Jugend in Lüneburg in den Siebzigern, ein Nicht-Studium in Hamburg, einen Wehrdienst auf Sylt und ein Leben in Wien (ab 1984). Also vulgo um einen Entwicklungsroman, der satt autobiographisch grundiert ist.
Schließlich ist der 1961 geborene Dirk Wesenberg - wie Rubinowitz mit bürgerlichem Namen heißt - einen ziemlich ähnlichen Weg gegangen wie sein Künstlerego Tex: Schulabbruch 1978, Gelegenheitsjobs, etwa als Joghurtabfüller (für "Lünebest Spezialjoghurt"), und Gelegenheitslieben ohne viel Sex; Überlebenskünstlereien da und dort und Dienst als Bundeswehr-Bremsschirmpacker für "Phantom"-Flugzeuge; endlich eine Existenz als Zeichner, Musiker, Cartoonist und Schriftsteller in Wien. Diesen Lebenslauf dekliniert Rubinowitz mit Witz und in einem weiten Pop-Referenzrahmen durch - als beschwingt-beschwipstes Plauderstück, samt Songliste im Anhang.
"Ich hatte schon immer geschrieben ... ich habe Listen geschrieben, all die Dinge, die ich zum ersten Mal gemacht habe, aufgelistet, jeden Tag macht man ja irgendetwas neu ... natürlich auch Listen von Musiktiteln, solches Zeug, was Nick Hornby später ja auch gemacht hat, den ich aber damals noch nicht kannte. Tut das nicht jeder? Die fünf besten Buddy-Holly-Titel, die man auf einem Nachtflug zum Jupitermond Io mitnehmen und hören würde: 1. Ummm, Oh Yeah (Dearest) 2. Words of Love 3. Brown Eyed Handsome Man 4. Rave On 5. Let Her Go Into The Darkness. Elvis Presley habe ich noch nie verstanden. Man kann doch mit Buddy Holly und auch mit Roy Orbison viel größere Wirkung an Wildheit, an samtpfötiger Subversion und an Pathos erzielen als mit allem, was der feiste King je von sich gegeben hat."
So sprudelt und sprudelt das weiter und immer weiter, kommt vom Stöckchen aufs Hölzchen und auf die fetten Baumstämme, die Daseinsfragen. Das Buch ist selbst wie eine einzige lange Liste: Irgendwie gehört alles zusammen, ist aber halt doch auch heterogen, assoziativ, mäandernd. Es kommt mal großspurig, dann wieder mit angesagtem Understatement daher, ist logorrhoisch und zugleich sprachzweiflerisch. Und wir mäandern beflügelt mit, weil das Ganze so raffiniert einfach gefasst ist; und weil Rubinowitz so frei heraus die Besserwisser-Keule schwingt, dass wir vor so viel Musikgeschmack und Kunstkönnerschaft schlicht alle Waffen der Kritik strecken müssen.
Dass der Erzähler dem Leser zum Finale noch einmal eine lange Nase dreht und dem Lektor die Verantwortung für den kompletten Text zuschiebt, versteht sich bei so einer Prosa-Anlage von selbst. "SDGA: Sich den Gegebenheiten anpassen" - das ist das erklärte Motto des Autors und seines Erzählers. Und beim Lesen wird es unseres: Wir nehmen jede Schelmerei und jede Schwermütigkeit locker mit.
Tex Rubinowitz fragt: "Wie frei bin ich?", oder er resümiert: "Das bin nicht ich, der da spricht, es ist immer nur ein Echo, das ich produziere ... ich schreibe auf Wirkung, und ja, warum soll ich meinen Lektor nicht machen lassen? ... Bin das ich im Spiegel, oder ist das nur eine periodische Knotenkonfiguration?" Man wähnt sich in einem Germanistikseminar in den Neunzigern, nur ist der Ton lustiger. Literarisch ist dergleichen nicht wahnsinnig aufregend. Aber so viel Nostalgie mit so viel Esprit so ordentlich in eine Art ironiegetränkten Joghurt abzufüllen, das muss dem Autor erst mal einer nachmachen.
ALEXANDRA KEDVES
Tex Rubinowitz: "Irma".
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2015. 239 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das Buch ist, tja, wie soll man das sagen bei einem Text, der so nah an der autobiographischen Entblößung entlangbalanciert, das Buch ist bestürzend gut. Süddeutsche Zeitung