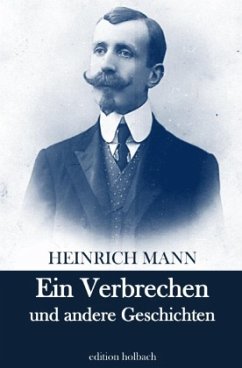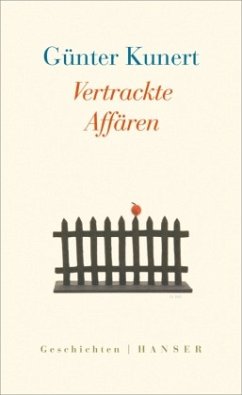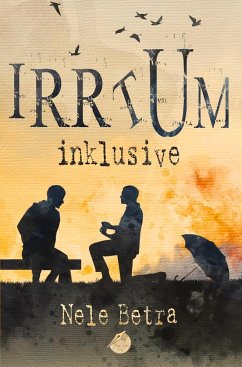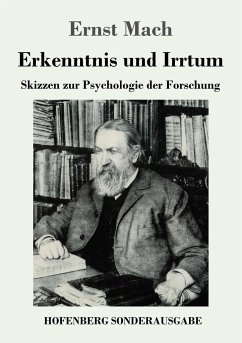Irrtum ausgeschlossen
Geschichten zwischen gestern und morgen
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
19,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In diesem Band sind die berühmtesten sowie die neuesten Texte Günter Kunerts vereinigt: Neben Bekanntem und Beliebtem wie 'Die Beerdigung findet in aller Stille statt' und 'Der Hai' findet sich Autobiographisches sowie zahlreiche neue und unbekannte Erzählungen. Alle haben eines gemeinsam: Sie spiegeln lebendig Günter Kunerts pointierten, bösartigen und immer ungeheuer komischen Erzählstil wieder.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.