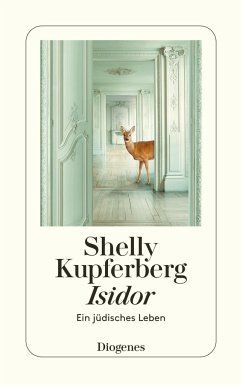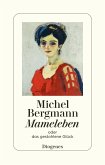Dr. Isidor Geller hat es geschafft: Er ist Kommerzialrat, Berater des österreichischen Staates, Multimillionär, Opernfreund und Kunstsammler und nach zwei gescheiterten Ehen Liebhaber einer wunderschönen Sängerin. Weit ist der Weg, den er aus dem hintersten, ärmlichsten Winkel Galiziens zurückgelegt hat, vom Schtetl in die obersten Kreise Wiens. Ihm kann keiner etwas anhaben, davon ist Isidor überzeugt. Und schon gar nicht diese vulgären Nationalsozialisten.
»Behutsam tasted sich Shelly Kupferberg an Isidors Schicksal heran, erzählt nicht nur von ihm, sondern auch von den Menschen um ihn herum.« Bettina Baltschev / MDR Kultur MDR Kultur
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Rezensentin Rose-Maria Gropp applaudiert Shelly Kupferberg für ein berührendes Buch über ihre eigene Familiengeschichte: Kupferbergs Urgroßonkel kam aus der tiefsten jüdischen Provinz, änderte seinen Namen von Israel zu Isidor und legte dann einen erstaunlichen und nahezu kometenhaften Aufstieg in der Wiener Haute Volée hin. Beeindruckt erzählt Gropp von der aufopferungsvollen Art, mit der sich der Kommerzienrat um seine Familie kümmerte: So zahlte er zum Beispiel dem Großvater der Autorin, Walter, sein Studium. Dieser hat ihr Isidors Lebensgeschichte erzählt und sie letztendlich motiviert, dieses Buch auch mithilfe von Archivmaterialien zu schreiben. Der Lebemann, einst geschätzt, beliebt und wohlhabend, wird Opfer der Nazis, er muss seinen ganzen Besitz aufgeben, wird gefoltert und stirbt schließlich entkräftet, bevor er die Flucht hätte antreten können, lernt die Kritikerin beinahe atemlos. Besonders erschüttert ist sie über eine Episode, die sich für Walter nach Kriegsende abspielt: Er kommt zum ersten Mal wieder nach Wien, die Nachbarn, die einige Möbelstücke der Familie haben, schlagen ihm, dem "Jud'", die Tür vor der Nase zu. Eine große Geschichte, die den ihr gebührenden Platz in der Holocaust-Literatur finden wird, schließt Gropp.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kein Roman, sondern ein literarisch gefasster Bericht: Shelly Kupferberg berichtet in "Isidor" über ein jüdisches Leben in Wien, das die Nationalsozialisten vernichteten
"Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor. Oder Innozenz. Oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch. Also Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Er war ein Emporkömmling, exzentrisch, ein Parvenü, ein Multimillionär, hier und da ein Hochstapler, ein Mann der Tat und von Welt, er war eigensinnig und voller Stolz. Wie sonst lässt sich sein Aufstieg aus dem hinterletzten ärmlichen Winkel Ostgaliziens bis in die K.-u.-k.-Metropole Wien zum Kommerzienrat und wirtschaftlichen Berater des österreichischen Staates erklären?" So beginnt Shelly Kupferberg ihr Buch "Isidor - Ein jüdisches Leben".
Der "hinterletzte Winkel", in dem Isidor Ende des neunzehnten Jahrhunderts geboren wurde, heißt Lokutni in der Nähe von Lemberg, das heute Lwiw heißt und in der Westukraine liegt. Der Vater war ein Talmudgelehrter, die Mutter brachte mit ihrer Arbeit die Familie mit fünf Kindern durch, die auch ihren Nachnamen Geller trugen, weil kein Standesamt bei einer orthodoxen Ehe infrage kam. Drei von ihnen werden es später aus der Enge des Schtetl nach Wien schaffen: Israel, eben Isidor, sein Bruder Rubin, fortan Rudolf, und die Schwester Fejge, die sich Franziska nennt. Ihr Sohn Walter, den dessen Onkel Isidor unter seine Fittiche nahm, war Shelly Kupferbergs Großvater, seinen Berichten verdankt sie viel für ihre aufwühlende Geschichte.
Shelly Kupferberg ist Journalistin, sie wollte wissen, wer dieser Urgroßonkel war, der keine eigenen Nachkommen hatte, und sie hat recherchiert, auch in Österreichs Archiven, die sich ihr hilfreich öffneten. Sie wollte sein Schicksal erkunden und auch herausfinden, wo die Kunstschätze und Antiquitäten, der wertvolle Besitz Isidors hingekommen sein könnten, der ein großes Haus in der Canovagasse, im 1. Bezirk von Wien, führte, in einem Rothschild-Palais. Dafür arbeitete sie mit Rekonstruktion und Imagination - ein "Puzzle" nennt sie das selbst, dessen Teile sie klug verschränkt zu einem Gesamtbild, das so auch über Isidor Gellers individuelle Vita hinausreicht. Die ihr anvertrauten Erinnerungen aus der Familie, die Belege aus den Dokumenten wechseln ab mit erzählerischen Passagen ohne jede Larmoyanz, zugleich mit der Schärfe, die der Katastrophe der Schoa angemessen ist. Deshalb ist "Isidor" kein Roman, sondern eine bewegende Studie von literarischem Rang.
Die Kupferberg leitende Frage heißt: Warum wollte ihr Urgroßonkel übersehen, was sich längst angekündigt hatte in Wien, eigentlich schon, als er dort Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ankam, noch vor dem "Anschluss" Österreichs 1938 durch die Nationalsozialisten? Sie erkundet die Wege seines Aufstiegs seit dem Ersten Weltkrieg, wo er aufgrund seiner Begabungen und seines kaufmännischen Geschicks zum Direktor in der Lederwarenbranche avancierte, als "Leiter eines Unternehmens, das die Rohstoffe für die Ausrüstung des Militärs herstellte", was ihn von der Front befreite. Sie sieht, dass er sein Vermögen nicht ohne gelegentliche Nebengeschäfte ansammeln konnte. Eine Ehe Isidors zerbricht da: "Doch nun war er frei, steinreich, und es begann der fröhliche Teil seines Lebens. Isidor war ein gemachter Mann, und das wollte er jedem zeigen, der es wissen wollte - oder auch nicht!" Vor allem aber sieht Kupferberg, dass Isidor die gefährliche Lage verkannte. Denn er hätte ahnen müssen, was ihm dann spätestens nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten drohte, zumal der Antisemitismus auch in Österreich längst nicht mehr zu übersehen war, und er hätte wohl die Mittel und Möglichkeiten gehabt, rechtzeitig zu fliehen.
Seine hohen Ambitionen und seine Begeisterung für die schönen Künste, allen voran die Oper, reißen ihn aber weiter mit im gesellschaftlichen Leben Wiens, weg von der Realität. Er gibt in seiner geräumigen Wohnung begehrte Dinner für die Hautevolee der Stadt, ist als Lebemann bekannt und fördert seine attraktive Geliebte Ilona Hajmássy, die aus einer verarmten ungarischen Familie kommt und als Sängerin dilettiert. Sie verlässt allerdings schon 1937 Wien Richtung Hollywood. Dort hat sie, nun als Ilona Massey, sogar einigen Erfolg, so wird sie 1949, mehr als zehn Jahre nach Isidors Tod, in dem Film "Love Happy" (deutsch: "Die Marx Brothers im Theater") mitspielen, in dem auch Marilyn Monroe einen kleinen Auftritt hatte.
Ihrem Großvater Walter, zu dem Isidor eine enge Beziehung aufbaute und dessen Studium er finanzierte, gibt Kupferberg die Rolle des jugendlichen Beobachters, der ihn auch zu warnen versuchte, als die Nationalsozialisten ihren Terror gegen die jüdische Bevölkerung von Wien begannen. Doch der Onkel blieb zu lange in seiner Verkennung oder Verdrängung der Lage verfangen, bis er 1938 von der Gestapo verhaftet wurde. In einem Schulgebäude, das als provisorisches Gefängnis diente, wurde er über Monate mit anderen Glaubensgenossen gequält und geprügelt, bis er schließlich die Übergabe seiner Wertpapiere unterschrieb. Seine eigenen jahrelangen Bediensteten hatten Isidor Geller zuvor denunziert. Shelly Kupferberg schildert das Geschehen in ruhigen Sätzen, die doch vor Abscheu vibrieren.
Er konnte in die Canovagasse zurückkehren, zu Tode entkräftet. Die Schwester Franziska blieb bei ihm, um ihn zu pflegen, auch sein Neffe Walter war bis zu dessen eigener Emigration nach Palästina an seiner Seite, während die Schergen des neuen Regimes die Bestände in der Wohnung, vom wertvollen Mobiliar bis hin zu "2 Sportpelzen (einer kurz, einer lang)" auf Listen katalogisierten. Alles wurde konfisziert, Isidor hätte es zurücklassen müssen, wenn er seinen nun doch gefassten Plan, Wien zu verlassen, noch hätte verwirklichen können. Was ihm verblieben war, wollte er an seine einstige Geliebte nach Hollywood verschicken, dazu kam es nicht mehr. Isidor Geller starb am 17. November 1938.
Shelly Kupferbergs Großvater war der Historiker Walter Grab, der 1971 das Institut für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv gründete und bis zu seiner Emeritierung 1986 leitete. Als er 1956 erstmals wieder nach Wien reiste, so berichtet sie gleich am Anfang, ging er zur elterlichen Wohnung am Bauernfeldplatz. Er fand den Namen des einstigen Hausbesorgerpaars, nun in einer höheren Etage, und klingelte. Als ihm die Frau an der Wohnungstür öffnete und ihn erkannte, rief sie: "Der Jud' is wieda doa!" und schlug die Tür zu. Im Hintergrund konnte Walter Möbel seiner Eltern ausmachen. Er blieb daraufhin im 1948 gegründeten Staat Israel, wo auch Kupferberg 1974 geboren wurde, die in Westberlin aufwuchs und heute noch lebt.
Im Buch erwähnt die Autorin die Fotoalben ihrer Großeltern, auf denen ihre Verwandten zu sehen sind, die sie - wie auch andere Gefährten des Urgroßonkels - in Nebensträngen einprägsam porträtiert. Man kann bedauern, dass keine Fotografien im Buch abgebildet sind, man hätte gern in diese Gesichter geschaut. Aber vielleicht wollte Shelly Kupferberg genau diese Einfühlung in ein Einzelschicksal vermeiden, um die Gültigkeit ihrer Geschichte darüber hinaus einzuschreiben ins Gedächtnis des Holocausts. Das ist ihr gelungen, auf ergreifende Weise. ROSE-MARIA GROPP
Shelly Kupferberg: "Isidor". Ein jüdisches Leben.
Diogenes Verlag, Zürich 2022. 247 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main