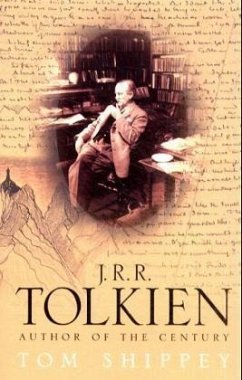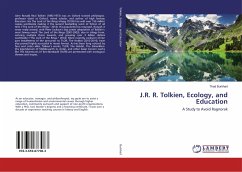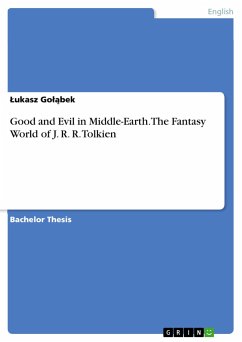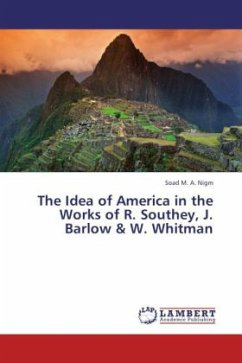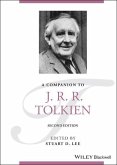Produktdetails
- Verlag: HarperCollins UK
- Seitenzahl: 347
- Englisch
- Abmessung: 200mm
- Gewicht: 258g
- ISBN-13: 9780261104013
- Artikelnr.: 10125418
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Bitte keine Exegese: Tom Shippeys Tolkien-Studien
Welcher Autor, so fragte neulich eine englische Kritikerin, ist das: um 1890 geboren, schrieb ein kurzes, erfolgreiches erstes Buch; dann ein langes und kompliziertes, in dem dieselben Figuren wieder auftauchen und in dem Sprachspiel und Mythos von zentraler Bedeutung sind; schließlich ein Spätwerk: monumental, monomanisch, unlesbar? Die Antwort ist natürlich Joyce: "Porträt des Künstlers", "Ulysses" und "Finnegans Wake". Aber sie könnte genauso gut Tolkien heißen: "Der Hobbit", "Der Herr der Ringe" und "Das Silmarillion". Vor etwa zehn Jahren wäre es schlichtweg albern erschienen, den Fantasy-Autor neben den Gottvater der Moderne zu setzen. Inzwischen mag uns Tolkien vielleicht etwas weniger kindisch erscheinen, während der Meister der Glottolalie auch nicht mehr ohne das Kindische zu denken ist. Man sollte die beiden nicht gegeneinander ausspielen, genausowenig wie die elitäre gegen die Massenkultur. Eine Versuchung bleibt das immer für Kritiker. So etwa, als 1996 das Ergebnis einer Umfrage manchen Kunstrichter irritierte. Die Frage ging nach den fünf besten Büchern des Jahrhunderts, die Mehrheit der Leser entschied sich für den "Herrn der Ringe". Nur in Wales erreichte "Ulysses" den ersten Platz. Zum Ärger so mancher Intellektueller bestätigten spätere Umfragen dieses Ergebnis immer wieder. Tom Shippey, einer der besten Kenner des Werks von Tolkien, bezieht sich in seinem neuen Buch - nach "The Road to Middle-Earth" - des öfteren auf Joyce. Dabei geht es ihm sicherlich auch um eine Aufwertung Tolkiens. Doch will er zugleich zeigen, wie sehr beide Autoren in ihrem Jahrhundert verwurzelt sind, mögen sie sich auch noch so sehr in die Labyrinthe von Vorgeschichte, Mythos und Sprache verirren.
Gleich zu Eingang kommt die überraschende These, der vorherrschende literarische Modus im zwanzigsten Jahrhundert sei das Phantastische. Eine These, die durch eine doch etwas anglozentrische Liste zustande gekommen ist, denn Shippey führt als Beleg eine Liste von Orwell und Golding bis hin zu Pynchon, LeGuin und Pratchett auf. Es fehlt nicht nur der Horizont der europäischen, gar Weltliteratur, sondern auch englischsprachige Autoren wie Virginia Woolf, D. H. Lawrence oder (wiederum) Orwell könnten solch voreilige Beobachtungen irritieren. Aber Shippey agiert aus der Defensive; er muß überziehen, um richtigzustellen. Seine Gegner sind die Snobs der akademischen und literarischen Welt, zu deren Götzenkult die routinierte Abkanzelung von Tolkien und Co. gehört. Was Shippey an Gegenwartskultur fehlt, holt er durch sein Wissen über die altenglische und altnordische Kultur und Sprache wieder ein. Schließlich lehrt er dieselben Fächer in Oxford, die einst Tolkien vertrat. Wie Tolkien geht es ihm um die Untrennbarkeit von Literatur und Linguistik, eine Vorstellung, die einen bei der heutigen Spezialisierung ins Grübeln bringt. Tolkiens These lautete, daß Sprache und Erzählung, "the tongue and the tale", aus derselben Einheit hervorgingen. Der Sprachphilosoph Owen Barfield, ein Mitglied jener legendären Inklings, zu denen Tolkien gehörte, hatte ihn auf diese Idee gebracht. Barfields "Evolution des Bewußtseins" ist an den sprachlichen Fossilien ablesbar. Tolkien setzt diese Erkenntnismöglichkeit um in eine Rekonstruktion von Mythen und Sprachen. Wie kein anderes Werk des zwanzigsten Jahrhunderts - wieder einmal abgesehen von Joyce - ist Tolkiens Opus aus dem Geist der Philologie geboren und von einer tiefen Liebe zur Sprache geprägt. Eine Stärke von Shippeys Buch bilden denn auch die genauen Analysen von Namen wie Baggins, Saruman oder Hobbit und ihrer etymologischen, literarischen und sozialhistorischen Schwingungsfelder. Shippey kann hier die Lektüre Tolkiens mit seiner Kenntnis des "Beowulf", der altenglischen Literatur und der isländischen Sagas bereichern und erweitern. Er verhilft auch zu einer neuen Einschätzung der Tolkienschen Leistung als einer beeindruckenden Beherrschung von Sprache in ihren verschiedenen historischen und stilistischen Ebenen. Man bekommt Einblick in die sorgfältige handwerkliche Arbeit mit ihren endlosen Revisionen, die Tolkien seinem Werk angedeihen ließ.
Warum, so fragt sich Shippey immer wieder, wird Tolkien so gerne gelesen? Ginge es nur um die Flucht ins Phantastische, so wäre die auch billiger zu haben. Tolkien verlangt seinen Lesern eine Menge ab, gleichzeitig bietet er ihnen aber auch einen Zugang. Shippey findet ihn in einem grundlegenden Anachronismus. Auf der einen Seite verfolgte Tolkien ein Projekt wie Lönnrot, der die finnische "Kalevala" erdichtete. Es bestand darin, das fragmentarische Wissen, das wir über unsere Frühgeschichte aus Märchen, Sprüchen und Rätseln haben, zu einem zusammenhängenden Kosmos zu verbinden - einem Kosmos, der letztlich fremd, ungeheuerlich und erschreckend bleiben muß, voller nichtmenschlicher und menschenähnlicher Intelligenzformen, die "uns" an den verschiedenen Gabelungen der Evolution begegnet sein müssen. Auf der anderen Seite erschafft Tolkien Figuren, die nach Sprache und Wertsystem unserer Zeit entstammen. Was in einer vergessenen Tiefe der Zeiten spielt, wird von englischen Bürgern der Mittelschicht erlebt. Diese Hobbits rauchen ein Kraut in der Pfeife, das tabakähnlich ist, zumindest ist "Tabaksdose" das letzte Wort in "Der Hobbit", doch Tabak ist in England erst seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts belegt. Weiterhin genießen sie eine Postzustellung, die es so in England erst seit 1837 gibt. Diese Freunde des guten Lebens mit ihren Gärten und Höhlen passen überhaupt nicht nach Mittelerde mit seinen Drachen, Orks, Ents und Balrogs. Genau in dieser fehlenden Anpassung aber liegt nach Shippey der Reiz dieser Geschichten.
Bekanntlich lehnte Tolkien jede allegorische Interpretation seiner Ringerzählung ab - ob als Kommentar zu Hitler oder zur Atombombe. Sein Exeget ist da vorsichtiger und überläßt die Anwendung lieber den Lesern. Ob Hippies, Osteuropäer vor der Perestroika oder Ökologen: Sie alle haben sich Tolkiens Welt zunutze gemacht, weil diese doch teilweise immer die des zwanzigsten Jahrhunderts war. Auch Tolkiens Phantasie kam nicht ungeschoren durch die Abgründe der Epoche, zumal er selbst als Soldat den Ersten Weltkrieg erlebt hatte. Diese Erfahrungen haben ihn belehrt, daß das Böse nicht so einfach zu fassen ist. Shippey konstatiert denn auch zwei verschiedene Sichtweisen des Bösen, die bei Tolkien im Konflikt liegen: ein inneres und ein äußeres Böses.
Man mag weiterhin Zweifel hegen gegen die hier verborgenen ideologischen Sedimente. Doch sollte man dabei nicht übersehen, daß der Zweifel selbst Teil des Werkes ist: der Zweifel des literarischen Schöpfers gegenüber diesem Versuch, Moderne mit Mythos zu verbinden. Tolkien wußte oft lange nicht, wohin sich die Geschichten entwickeln würden. Der Zwang zu Kartenwerken deutet auf Orientierungsprobleme. Noch deutlicher wird der künstlerische Zweifel in einigen Erzählungen wie "Leaf by Niggle". Im Zentrum des "Herrn der Ringe" steht, wie bei vielen Werken der Moderne, das Scheitern. Tolkien und seine Inklingsfreunde scheuten sich nicht, vom Sündenfall und dessen Folgen zu sprechen. Bei Tolkien gibt es keinen Anlaß zum blinden Optimismus, wie ihm oft vorgeworfen wird, wohl aber zum Mut. Und Shippeys Buch zeigt, daß Tolkien mehr verdient hat als die reflexhafte Abfertigung.
ELMAR SCHENKEL
Tom Shippey: "J. R. R. Tolkien. Autor des Jahrhunderts". Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Krege. Verlag Klett-Cotta Stuttgart, 2002. 393 S., geb., 25,-
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main