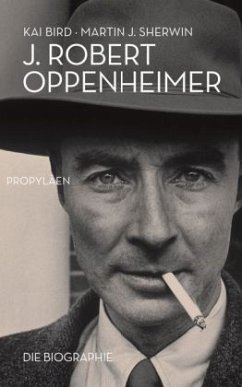'J. Robert Oppenheimer (1904-1967), der "Vater der Atombombe", zählt zu den schillerndsten Figuren der jüngeren Zeitgeschichte. Für ihre glänzende Biographie des "amerikanischen Prometheus" erhielten der Journalist Kai Bird und der Historiker Martin J. Sherwin den Pulitzer-Preis. Exemplarisch lassen sie das Drama eines Forschers lebendig werden, der sich zwischen Erkenntnisdrang und ethischer Verantwortung entscheiden muss.
Oppenheimer leitete das streng geheime Manhattan-Projekt in der Wüste von New Mexico, wo am 16. Juli 1945 die erste Atombombe gezündet wurde. Kurz darauf starben in Hiroshima und Nagasaki mehr als 200 000 Menschen durch die neue "Wunderwaffe" - die Menschheit war ins Atomzeitalter eingetreten. Erschüttert von der Zerstörungskraft seiner Schöpfung, engagierte sich Oppenheimer fortan gegen den Einsatz nuklearer Waffen. Das machte ihn im Amerika der McCarthy-Ära verdächtig. Er geriet ins Visier des FBI, wurde als Spion der Sowjetunion verleumdet und musste den Staatsdienst quittieren. Sein Privatleben wurde an die Öffentlichkeit gezerrt, seine Wohnung verwanzt, sein Telefon abgehört. Erst 1963 rehabilitierte ihn Präsident Kennedy.
Über dreißig Jahre hinweg haben die Autoren Interviews mit Oppenheimers Angehörigen, Freunden und Kollegen geführt, FBI-Akten gesichtet, Tonbänder von Reden und Verhören ausgewertet und Oppenheimers private Aufzeichnungen eingesehen. Ihre beeindruckend gründliche Biographie gewährt intimen Einblick in diese charismatische Persönlichkeit, bei der Triumph und Tragik so nahe beieinander lagen.
Oppenheimer leitete das streng geheime Manhattan-Projekt in der Wüste von New Mexico, wo am 16. Juli 1945 die erste Atombombe gezündet wurde. Kurz darauf starben in Hiroshima und Nagasaki mehr als 200 000 Menschen durch die neue "Wunderwaffe" - die Menschheit war ins Atomzeitalter eingetreten. Erschüttert von der Zerstörungskraft seiner Schöpfung, engagierte sich Oppenheimer fortan gegen den Einsatz nuklearer Waffen. Das machte ihn im Amerika der McCarthy-Ära verdächtig. Er geriet ins Visier des FBI, wurde als Spion der Sowjetunion verleumdet und musste den Staatsdienst quittieren. Sein Privatleben wurde an die Öffentlichkeit gezerrt, seine Wohnung verwanzt, sein Telefon abgehört. Erst 1963 rehabilitierte ihn Präsident Kennedy.
Über dreißig Jahre hinweg haben die Autoren Interviews mit Oppenheimers Angehörigen, Freunden und Kollegen geführt, FBI-Akten gesichtet, Tonbänder von Reden und Verhören ausgewertet und Oppenheimers private Aufzeichnungen eingesehen. Ihre beeindruckend gründliche Biographie gewährt intimen Einblick in diese charismatische Persönlichkeit, bei der Triumph und Tragik so nahe beieinander lagen.

Ein Lebensbild, in dem zum ersten Mal die Ambivalenzen ausgeleuchtet werden, die den Vater der Atombombe umtrieben: Martin Sherwins und Kai Birds große Biographie des J. Robert Oppenheimer.
Von Helmut Mayer
Zum "Vater der Atombombe" wurde J. Robert Oppenheimer im Alter von einundvierzig Jahren am 16. Juli 1945. Obwohl von einer Bombe nicht die Rede war, als damals ihr erstes Exemplar explodierte: Es war immer noch "the gadget", das an diesem Morgen auf einer Wüstenhochebene von New Mexico erfolgreich gezündet wurde. Oppenheimer hatte den Testplatz ausgewählt und "Trinity" genannt. Wie er auf diesen Namen gekommen war, daran konnte er sich später nicht mehr genau erinnern; vielleicht sei es wegen eines Gedichts von John Donne gewesen, das mit der Zeile beginnt: "Batter my heart, three-person'd God". Andere wollten darin einen Verweis auf die hinduistische Dreifaltigkeit von Brahma, Vishnu und Shiva sehen. Wohl deshalb, weil Oppenheimer viel später nicht ohne verhaltene Feierlichkeit erzählte, ihm seien beim Anblick der über "Ground Zero" sich auftürmenden Wolke Verse aus der Bhagavad-Gita in den Sinn gekommen: "Nun bin ich der Tod geworden, der alles raubt, Erschütterer der Welten."
Damit musste man bei einem Mann rechnen, der Sanskrit gelernt hatte, die Alten im Original las und überdies ein exzellenter Kenner französischer Literatur war. Keine Neigungen, die man bei einem theoretischen Physiker, der zum Leiter des geheimen amerikanischen Atomwaffenlabors in Los Alamos geworden war, ohne weiteres vermuten würde. Aber dieser schmale nervöse Mann mit dem Porkpie-Hut hatte viele Facetten: ein theoretischer Physiker, dessen Zugriff auf Probleme brillant war, der aber selten langen Atem bei ihrer Verfolgung zeigte; ein Intellektueller mit literarischen Passionen - selbst auf Trinity soll er hin und wieder eine Ausgabe von Baudelaires "Fleurs du mal" aus der Tasche gezogen haben -, dessen Führungsleistungen Militärs wie Politikern Respekt abnötigten; ein charismatischer Redner und charmanter Unterhalter, der um seine Wirkung wusste und doch in tiefe Selbstzweifel abstürzen konnte; ein Mann des schneidenden Worts und der knappen Abfertigung wie der aufmerksamen Zuwendung; ein exzellenter Lehrer und Wissenschaftsorganisator, der doch immer auch brüskierte und Widerstand auf den Plan rief.
Es würde den "Fall Oppenheimer", seinen Sturz als Berater höchster Washingtoner Regierungskreise in Atomfragen, nicht einmal gebraucht haben, um diesen Mann faszinierend zu finden. Aber mit den Anhörungen vor dem Ausschuss der amerikanischen Atomenergiebehörde, die 1954 zu seinem Ausschluss aus dem Kreis der Geheimnisträger führten, wurde Oppenheimer zu einer Figur, mit der eine ganze Reihe von Fragen über den Zusammenhang von Grundlagenforschung und Gesellschaft, Politik und Wissenschaft in Zeiten des Kalten Kriegs auf unübersehbare und öffentlichkeitswirksame Weise verknüpft waren.
Es mangelt nicht an Versuchen, ein Bild dieses Mannes zu entwerfen, den ein Freund und Kollege am Institute for Advanced Study in Princeton als "Bündel wunderbarer Widersprüche" beschrieb. Der wohl immer noch berühmteste hat die Form eines Theaterstücks: Heinar Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimer" von 1964. Es endet mit jenem fiktiven Eingeständnis der Hauptfigur, die "Arbeit des Teufels" getan zu haben und nun wieder zur reinen Forschung zurückkehren zu wollen, das Oppenheimer auf die Palme brachte. So einfach war die Sache nicht, die Ambivalenzen reichten viel tiefer. In der großen Biographie von Kai Bird und Martin Sherwin, die nun auch auf Deutsch vorliegt, werden sie ausgelotet.
Es beginnt mit dem frühreifen Jungen aus wohlhabendem jüdischen Haus in New York, in das die als Malerin ausgebildete Mutter einen künstlerischen Einschlag brachte: Von seinen Eltern erworbene Gemälde von Derain, Vuillard oder van Gogh hängen später in Oppenheimers Häusern. Als er sein Studium in Harvard aufnimmt, ändert auch die Entscheidung zuerst für die Chemie und schließlich für die Physik nichts an der Breite seiner Interessen und an seiner intensiven Beschäftigung mit Literatur.
In Cambridge fällt dann, nach einer quälenden Zeit mit Laborarbeit und psychischen Turbulenzen, aus der ihn die Lektüre von Prousts "Recherche" mehr als der psychoanalytische Beistand befreit haben soll, die definitive Entscheidung zur Theorie. Er stürzt sich auf die Quantenmechanik und braucht nicht lange, um die ersten Aufsätze vorzulegen, die seinen gewitzten Umgang mit dem neuen Rüstzeug zeigen. Max Born holt ihn darauf nach Göttingen, wo Oppenheimer sich als Wunderkind und auch etwas anstrengend erweist, weil er im Seminar jeden jederzeit unterbricht, um seine Sicht des gerade behandelten Problems darzulegen. Den Göttingern attestierte er in einem launigen Brief eine Verbindung von "fantastisch unerschütterlicher metaphysischer Hinterhältigkeit mit den draufgängerischen Gewohnheiten von Tapetenherstellern" - und ist in seinem Element.
Als Oppenheimer nach rasant erledigter Doktorarbeit und anschließenden Semestern bei Ehrenfest in Leyden und Pauli in Zürich 1929 in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, ist die Basis für seine Profilierung als innovativer Theoretiker auf dem Feld der Atomphysik gelegt. Die enge Verbindung mit den experimentellen Möglichkeiten versteht sich im amerikanischen Kontext fast von selbst. Das "Radiation Laboratory" von Berkeley, das schrittweise größer werdende Zyklotrone in Betrieb nimmt, bietet dazu vorzügliche Gelegenheit.
Im "RadLab" wird einem ungläubigen Oppenheimer denn auch 1939, unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses von Hahn und Strassmann, eine Kernspaltung vorgeführt. Kaum haben ihn die Kurven auf dem Oszilloskop überzeugt, sieht er auch schon die Bombe als theoretische Möglichkeit. Einige Monate später schicken Szilard und Einstein ihren Brief an Roosevelt, und im Sommer 1941 kommen die amerikanischen Anstrengungen zum Bau der Bombe in Fahrt.
Für Oppenheimer, der in den dreißiger Jahren unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Depression und des Krieges gewerkschaftlich gearbeitet und die Internationalen Brigaden in Spanien unterstützt hatte, ist die Mitarbeit an diesem Programm keine Frage. Es gilt, den Deutschen zuvorzukommen und den Faschismus in die Knie zu zwingen. Nur die Bombe, so Oppenheimer immer wieder, kann Hitler stoppen.
Es ist seine Idee eines zentralen Labors an einem abgelegenen Ort, die Leslie Groves als militärischer Leiter des "Manhattan-Projekts" übernimmt - und Oppenheimer gegen die Sicherheitsbedenken des FBI wegen dessen Kontakten zu kommunistischen Kreisen als wissenschaftlichen Direktor von Los Alamos durchsetzt. Auch die Kollegen Oppenheimers sind skeptisch, aber der Erfolg gibt Groves recht. Im Rückblick auf die zweieinhalb Jahre in der auf sechstausend Bewohner anwachsenden Forschungsstadt im militärischen Sperrbezirk sind sich später fast alle einig: Ohne Oppenheimers Führungstalent, seine Präsenz und sein genaues Wissen um die gerade zu bewältigenden Probleme wäre das Ziel nicht so schnell erreicht worden.
Aber als es im Frühjahr 1945 fast schon so weit ist, hat sich die Kriegslage geändert. Deutschland ist besiegt, und die deutschen Physiker, gegen die man sich im Wettlauf geglaubt hatte, waren nicht einmal in die Nähe einer funktionsfähigen Bombe gekommen. Vor diesem Hintergrund finden die von Niels Bohr und einigen anderen angestoßenen Überlegungen zu einer internationalen Verständigung über Verwendung und Kontrolle spaltbaren Materials in der Wissenschaftlergemeinschaft deutliche Resonanz. Auch bei Oppenheimer, der sich aber zu einer Empfehlung an die Regierung, den ins Auge gefassten Einsatz gegen Japan zu unterlassen oder zumindest vor ihm zu warnen und auch die - immerhin verbündete - Sowjetunion in die Planungen einzubeziehen, nicht entschließen kann. Der von ihm geleitete Wissenschaftlerbeirat optierte im Juni letztlich gegen eine Demonstration der Zerstörungskraft der Bombe auf einer unbewohnten Insel und für ein militärisches Ziel in dichtbewohntem Umland. Und sollte der Abwurf nicht zeigen können, dass eine solche Bombe in keinem Krieg mehr einzusetzen ist?
Nach Kriegsende versucht Oppenheimer seine hohen Beraterpositionen zu nutzen, um die anvisierten internationalen Kontrollmaßnahmen in Reichweite zu bringen. Obwohl er noch im Oktober für eine Gesetzesvorlage optiert, die alle atomaren Angelegenheiten unter militärische Aufsicht und Geheimhaltung stellen sollte und die erst nach massiven Protesten der "Federation of Atomic Scientists" gekippt wird: Einmal mehr übt er die Disziplin des Topberaters, der seinen Einfluss im inneren Zirkel der Macht geltend machen und nicht als opponierender Wissenschaftler auftreten möchte.
Aber so gut die Aussichten anfangs scheinen, über das amerikanische Positionspapier für die neugegründete "Internationale Atomenergiekommission" der UN eine starke übernationale Kontrollbehörde auf den Weg zu bringen, die alle Uranvorräte überwacht - die Sache entgleist auf dem politischen Parkett. Der Kalte Krieg kommt in Fahrt, der Antikommunismus an der Heimatfront auch, und Oppenheimer bleibt trotzdem im Beraterboot, während er sich von eigenen Forschungen abwendet. Aber er kritisiert das Geheimhaltungsparadigma, das die Öffentlichkeit der Bürger uninformiert hält, und denkt über die Rückstufung der Bombe in taktisch einsetzbare Waffen nach.
Dass er sich 1949 - die Sowjets haben gerade ihre erste Atombombe getestet - gegen das Sofortprogramm für die Entwicklung der Wasserstoffbombe ausspricht, wird ihm 1954 dann in den Anhörungen vor dem Ausschuss der Atomenergiebehörde zum Vorwurf gemacht. Der Aufhänger dieses Verfahrens sind Oppenheimers längst bekannte Kontakte zu kommunistischen Kreisen in den dreißiger Jahren und einige Merkwürdigkeiten, die er sich im Umgang mit den für Spionageabwehr zuständigen Offizieren des Atomprogramms geleistet hatte. Aber worum es tatsächlich ging, daran lassen auch Bird und Sherwin in ihrer detaillierten Schilderung der Vorgänge keinen Zweifel: Ausgeschaltet wurde ein prominenter Kritiker der favorisierten militärisch-politischen Strategie massiver Vergeltungsandrohung mit rasant wachsenden nuklearen Arsenalen. Und ein unzweifelhafter Patriot zudem, über dessen unglückliche Liebe zu Amerika Einstein spöttelte und dabei natürlich auf Oppenheimers Ehrgeiz zielte.
Die 1947 angetretene Leitung des Institute for Advanced Study kann Oppenheimer immerhin verteidigen. Er macht das Institut zu einem Zentrum der theoretischen Physik, kann aber auch seine Interessen abseits der Naturwissenschaften spielen lassen und denkt - nunmehr als charismatischer Außenseiter - öffentlich über die sich verändernde Rolle der Wissenschaften nach. Unter Kennedy erfolgt zwar die Wiedergutmachung von Seiten Washingtons, aber eine Rückkehr in die alte Beraterrolle fasst er nicht mehr ins Auge. Als er die Leitung des Princetoner Institut im Frühjahr 1965 niederlegt, bleiben ihm nur noch knapp zwei Jahre bis zu seinem frühen Tod.
Bei Sherwin und Bird erfährt man eher wenig über die späteren Aufsätze und Vorträge Oppenheimers. Doch wird das mehr als aufgewogen vom Reichtum der biographischen Zeugnisse, die die Autoren erschlossen und in ihrer Darstellung verarbeitet haben. Man glaubt in ihr die nervöse Energie dieses Mannes spüren zu können, den Ehrgeiz, auch die schwierigsten Situationen und selbst die Überforderungen noch bewältigen zu können. Man hat die Wirkung seines Auftretens vor sich, gespiegelt von den unterschiedlichsten Beobachtern, die unheimliche Disziplin genauso wie eine gewisse intellektuelle und auch moralische Unschärfe, die sich von ihr nicht auflösen ließ. Mit anderen Worten: Diese Biographie gibt nicht nur ein hingebungsvoll detailliert gearbeitetes Bild, sondern auch ein lebendiges. Das Original trägt den Untertitel "The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", den die deutsche Ausgabe glücklicherweise gestrichen hat. Obwohl man es mit einem Buch zu tun hat, dem man selbst einen solch pathetischen Titel gerne nachsieht.
Kai Bird und Martin J. Sherwin: "J. Robert Oppenheimer". Die Biographie. Propyläen Verlag, Berlin 2009. 672 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
J. Robert Oppenheimer war ein Mann von Widersprüchen: Ein brillanter, aber sprunghafter Physiker, ein Mann aber auch, der die Weltliteratur liebte. Einer, der den inneren Zirkeln der Macht nahestand und zugleich Freunde unter Kommunisten hatte. Einer, der opponiert und dann wieder nicht. Diesen Mann zu fassen zu bekommen gelingt, wie Rezensent Helmut Mayer findet, den Autoren dieser Biografie ausgesprochen gut. Sie kehren nämlich das Widersprüchliche, die "Ambivalenzen", so Mayer keineswegs unter den Teppich. Genau vollziehen sie die Bewegungen seines Lebenswegs nach - und die Rezension, die über weite Strecken zum biografischen Referat wird, folgt ihnen darin. Am Ende ist der Rezensent dann des Lobes voll und freut sich, dass die Geschichte eines Lebens hier nicht nur "hingebungsvoll detailliert" nachgezeichnet, sondern dabei auch noch "lebendig" wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH