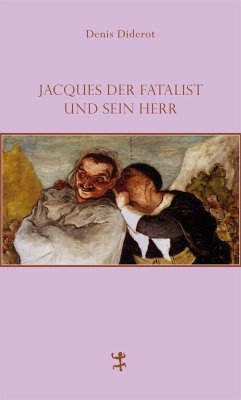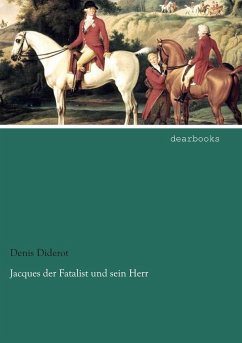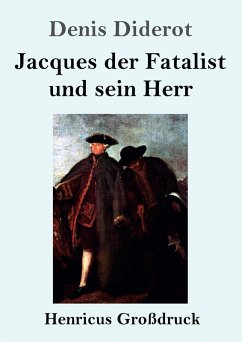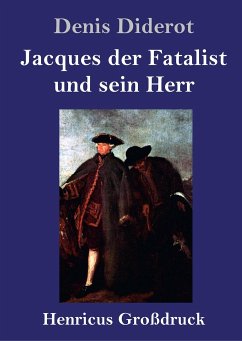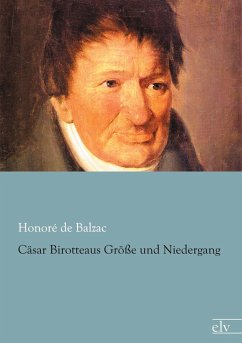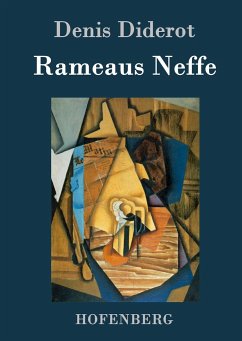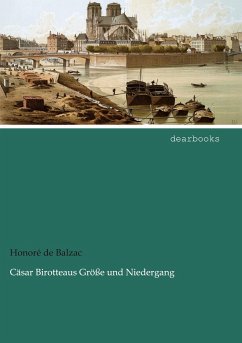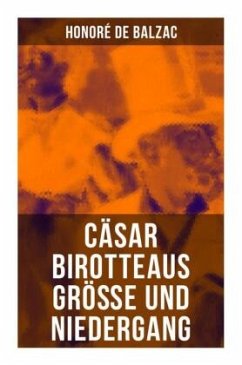Jacques der Fatalist und sein Herr
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
22,90 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dieser von Goethe, Hegel und Karl Marx bewunderte ironisch-philosophische Reiseroman des französische Philosophen und Enzyklopädisten Denis Diderot (1713-1784) konnte erst nach dessen Tod 1796 erscheinen: Der Diener Jacques und sein adliger Herr sind ohne erkennbares Ziel unterwegs und plaudern dabei miteinander. Ausgerechnet der agile und aufgeweckte Jacques erweist sich als Fatalist, der sein Leben in der himmlischen Schicksalsrolle vorgezeichnet sieht; sein träger und gelangweilter Herr dagegen bekennt sich, nicht minder paradox, zur Freiheit des Willens, ohne sie jedoch zu nutzen eine g...
Dieser von Goethe, Hegel und Karl Marx bewunderte ironisch-philosophische Reiseroman des französische Philosophen und Enzyklopädisten Denis Diderot (1713-1784) konnte erst nach dessen Tod 1796 erscheinen: Der Diener Jacques und sein adliger Herr sind ohne erkennbares Ziel unterwegs und plaudern dabei miteinander. Ausgerechnet der agile und aufgeweckte Jacques erweist sich als Fatalist, der sein Leben in der himmlischen Schicksalsrolle vorgezeichnet sieht; sein träger und gelangweilter Herr dagegen bekennt sich, nicht minder paradox, zur Freiheit des Willens, ohne sie jedoch zu nutzen eine groteske Konstellation, die Diderot zu einer von umfassenden Sozialkritik durchsetzten Darstellung des Herr-Knecht-Verhältnisses nutzt.