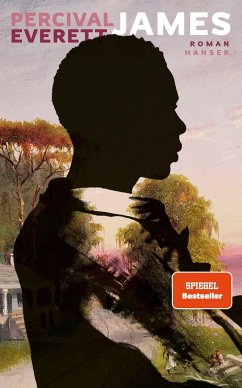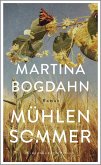"Huckleberry Finn" wird zum Roman der Freiheit - in "James" erfindet Percival Everett den Klassiker der amerikanischen Literatur neu. National Book Award 2024 Jim spielt den Dummen. Es wäre zu gefährlich, wenn die Weißen wüssten, wie intelligent und gebildet er ist. Als man ihn nach New Orleans verkaufen will, flieht er mit Huck gen Norden in die Freiheit. Auf dem Mississippi jagt ein Abenteuer das nächste: Stürme, Überschwemmungen, Begegnungen mit Betrügern und Blackface-Sängern. Immer wieder muss Jim mit seiner schwarzen Identität jonglieren, um sich und seinen jugendlichen Freund zu retten. Percival Everetts "James" ist einer der maßgeblichen Romane unserer Zeit, eine unerhörte Provokation, die an die Grundfesten des amerikanischen Mythos rührt. Ein auf den Kopf gestellter Klassiker, der uns aufrüttelt und fragt: Wie lesen wir heute? Fesselnd, komisch, subversiv.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Sylvia Staude freut sich, dass Percival Everett in seinem Roman eine "Twainsche Leerstelle" füllt. Denn der Autor schreibe hier in weiten Teilen an Mark Twains "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" entlang, nehme dabei aber die Perspektive des schwarzen Sklaven James bzw. Jim ein, der Huck auf seiner Reise begleitet. Wie der afroamerikanische Schriftsteller Sklaverei und Rassismus diesmal weniger blutig behandle als etwa im vorangegangenen Rache-Roman "Die Bäume", findet Staude spannend zu lesen: So lasse er seinen Protagonisten etwa einen sprachlichen "Sklavenfilter" einziehen, sobald er mit Weißen redet - aus der hochgebildeten Sprache Jims wird dann ein Slang, um der Erwartungshaltung des weißen Gegenübers zu entsprechen. Vorzüglich werde dies von Nikolaus Stingl übersetzt, lobt Staude. Ebenfalls spannend findet sie die Passagen, in denen Jim in einer Art Traum-Delirium mit Voltaire über dessen Begriff von Freiheit philosophiert und diesen dabei sogar zu gewissen Formulierungen inspiriert. Eine "realistische" Figur sei das natürlich nicht, und oft fungiere sie auch als erhobener Zeigefinger. Aber darum gehe es auch nicht in diesem "unterhaltsamen" und höchst "sprachbewussten" Roman, so Staude, sondern um den Anbruch einer neuen Zeit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der amerikanische Schriftsteller Percival Everett stellt Mark Twains "Huckleberry Finn" auf den Kopf: Aus dem naiven Jim des Romanklassikers wird ein Meister der Ironie. Und als solcher erweist sich denn auch der Autor des Romans "James".
Von Andreas Platthaus
Es ist erst wenige Tage her, dass über die Darstellung des Jim Knopf aus Michael Endes Kinderbüchern gestritten wurde, nachdem der Verlag als rassistisch interpretierte Charakteristika der Figur abgeändert hatte - in Wort und Bild. Die Empfindlichkeiten im öffentlichen Gespräch gerade über Fragen von Identität haben drastisch zugenommen, und ein gewachsener Stolz der Angehörigen von ehedem als randständig angesehenen gesellschaftlichen Gruppen geht einher mit ihrer apodiktischen Ablehnung jeglicher Form von Fremdzuschreibung, die nicht dem eigenen Bild entspricht. Verschärft wird diese Dichotomie durch das Beharren auf Exklusivität beim Gebrauch bestimmter Begrifflichkeiten - und zwar auf rechter wie linker Seite. Wie wäre da zu vermitteln?
Durch Kunstfertigkeit, der es gelingt, die heikle Auseinandersetzung geistvoll zu entschärfen, und ein Königsweg dabei ist Ironie. Wie sie Percival Everett mit seinem Roman "James" beweist. Wie sehr dieser Autor, geboren 1956 in Georgia und seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der University of Southern California in Los Angeles Literaturwissenschaft lehrend, als wichtiger Protagonist eines neuen schwarzen Selbstbewusstseins gilt, zeigt die Tatsache, dass "James" auf Deutsch einige Tage vor der amerikanischen Publikation erscheint. Der Hanser Verlag weiß, dass jenes aufgeklärte Publikum, für das Everett schreibt, polyglott ist und zum englischsprachigen Original greifen würde, um zu lesen, wie er aufs Herz der Debatte zielt.
"James" bedient sich einer literarischen Folie, eines der berühmtesten Romane überhaupt: "Huckleberry Finn" von Mark Twain, erschienen 1884. Doch auch der ist ungeachtet seines humanistischen Gegenstands - der jugendliche weiße Titelheld und der schwarze Sklave Jim fliehen gemeinsam aus ihrem Heimatort am Mississippi, um Jims Weiterverkauf zu verhindern - längst in den Fokus der Sprachkritik geraten. Was auch kaum zu verhindern war, hebt doch Mark Twains Roman mit folgender Erklärung an: "In diesem Buch werden mehrere Dialekte gesprochen, als da sind: der Negerdialekt von Missouri . . .", und dann folgen noch sechs weitere der weißen Bevölkerung, doch es ist der durch "Huckleberry Finn" kodifizierte Sklavenslang, der heute inopportun ist (um es höflich zu sagen).
Die jüngste der zahlreichen deutschen Übersetzungen, angefertigt 2010 von Andreas Nohl, merkt dazu kritisch an: "Die Liebenswürdigkeit des Charakters Jim kann über einen schwerwiegenden Mangel nicht hinwegtäuschen: Jim wird, obgleich er zwei Kinder hat und sicher über dreißig Jahre alt ist, in seinen Reaktionen nicht als erwachsener Mann gezeichnet. [...] Dies macht den Roman als Lektüre für afroamerikanische Kinder und Jugendliche und teilweise auch für ihre Eltern schwer erträglich, als Schulbuch indiskutabel." Gleichwohl hat "Huckleberry Finn" literarisch Schule gemacht wie sonst in den Vereinigten Staaten nur "Moby-Dick". Und Percival Everett verneigt sich am Schluss von "James" vor Mark Twain: "Sein Humor und seine Menschlichkeit haben mich beeinflusst, lange bevor ich Schriftsteller wurde."
Was aber stellt Everett nun damit an? Er verwandelt gerade das heute umstrittenste Element von "Huckleberry Finn", den Duktus von Jim, in eine große Farce, aufgeführt von den schwarzen Sklaven im Umgang mit ihren weißen Herren. Gleich zu Beginn erteilt Jim seiner Tochter und deren schwarzen Spielgefährten Sprachunterricht: "Die Weißen erwarten, dass wir auf eine bestimmte Weise klingen, und es kann nur nützlich sein, sie nicht zu enttäuschen. Wenn sie sich unterlegen fühlen, haben nur wir darunter zu leiden." So elaboriert und reflektiert diese Lektion klingt, so gewählt sprechen alle Schwarzen in Everetts Buch miteinander - bis sie in Hörweite von Weißen kommen. Dann benutzen sie den "Sklavenfilter", wie Jim dieses Verfahren nennt.
Oder besser gesagt: James. Denn Jim weiß, dass auch sein Name zur Sklavenidentität gehört. "Man nennt mich Jim", notiert er sich, als er zum ersten Mal zu schreiben wagt: "Ich muss mir erst noch einen Namen ausdenken." Das zweite Notat hebt dann schon so an: "Ich heiße James", und am Schluss, als er zurückkehrt, um seine Familie zu befreien, ist seine Selbstfindung im Schreibprozess vollendet: "Mein Name gehörte endlich mir." Auf seinem Rachefeldzug gegen die Peiniger von seinesgleichen wird er ihn einsetzen wie einen Fluch.
Jim ist ein anderer bei Everett; vor allem ist er auch Ich-Erzähler des Romans, übernimmt also die Rolle von Huck Finn, der in "James" zu einem kindlichen Jungen wird und damit wiederum jene Unselbständigkeit personifiziert, die Mark Twain für Jim reservierte. Ansonsten entspricht der neue Roman dem bekannten Verlauf des alten: Jim und Huck treffen sich zufällig auf Jackson's Island im Mississippi, wo sie beide Zuflucht gefunden haben und schlagen sich auf einem Floß nach Süden durch, um über den Ohio in einen jener Bundesstaaten zu gelangen, in denen die Sklaverei schon aufgehoben ist. Sie treffen auf das Gaunerpaar, das sich mit den Titeln eines Herzogs und des französischen Thronfolgers schmückt, werden mehrfach getrennt, und die Tatsache, dass Twain seinen Huck etliche Abenteuer ohne Jim bestreiten lässt, nutzt Everett zur Verknappung seines eigenen Romans, der nur halb so umfangreich ist wie das Vorbild. Er setzt jedoch die Kenntnis von Twains Buch voraus, wenn er etwa die tödliche Familienfehde zwischen den Sheperdsons und den Grangerfords auf nur drei Seiten abhandelt - und genauso überraschend, wie zu deren blutigem Finale bei Twain Jim wieder auftaucht, tut es nun bei Everett der Junge. Im Verlauf erweist sich "James" immer mehr als jener Rollentausch, den Percival Everett der ganzen amerikanischen Literatur nicht vor-, aber verschreibt: Schwarzes Leben rückt an die Stelle des weißen.
Das tut Everett bereits seit vierzig Jahren, aber auf Deutsch erschienen sind von seinen mehr als dreißig Büchern nur wenige: Als erste Übersetzung kam vor anderthalb Jahrzehnten "Ausradiert" (im Original "Erasure") heraus, bis heute der größte amerikanische Romanerfolg von Everett, der gerade erst unter dem Titel "American Fiction" verfilmt worden ist (und für fünf Oscars nominiert war). Bereits diesem in den Vereinigten Staaten 2001 erschienenen Buch war ein Motto von Mark Twain vorangestellt: "Ich könnte nie eine Lüge erzählen, die irgendjemand anzweifeln würde, und auch keine Wahrheit, die irgendjemand glauben würde." Everett erzählt darin die Geschichte eines schwarzen Literaturprofessors, dessen Romane kein Publikum finden, weil sie nicht in Ghettosprache abgefasst sind - bis er aus Zorn über die klischeegesättigten Bestseller anderer schwarzer Autoren auch solch ein Buch schreibt, unter Pseudonym. Natürlich wird es ein Riesenerfolg, doch nun muss der Intellektuelle die Rolle eines hartgesottenen Autors aus der Gosse spielen. Die Parallele zur erzwungenen schwarzen Selbstverleugnung als Thema von "James" zeigt, wie konsequent Everett seine Themen verfolgt.
Aber erst seit der heute Siebenundsechzigjährige jüngst ins Programm von Hanser aufgenommen wurde - vor "James" erschienen dort 2022 "Erschütterung" und 2023 "Die Bäume", beide ebenfalls von Nikolaus Stingl übersetzt -, hat er ein deutsches Publikum gefunden, obwohl es schon 2014 so aussah, als könnte er sich hierzulande etablieren: Damals erschienen gleich zwei Romane, "God's Country" und "Ich bin nicht Sidney Poitier", beides ebenso hochironische Spiele mit literarischen Topoi schwarzer Identität wie die drei Hanser-Titel. Aber es besteht kaum Zweifel, dass "James" die Wahrnehmung von Everett auf eine neue Ebene heben wird, nachdem sich die aberwitzig schwarze (humoristisch wie soziologisch) Krimifarce "Die Bäume" zum Verkaufsschlager entwickelt hat.
Stingl stand bei "James" vor ganz anderen Herausforderungen als bei seinen beiden früheren Everett-Romanen: "Versucht man, die speziellen Eigenarten des von Schwarzen gesprochenen Südstaatenenglisch im Deutschen nachzubilden, stößt man rasch an Grenzen bzw. läuft Gefahr, eine Art retardiertes, einfältiges Idiom zu produzieren." Durch Schaffung eines künstlichen Dialekts in phonetischer Schreibweise hat er das Problem gelöst, wobei Andreas Nohl oder Friedhelm Rathjen (zwei "Huckleberry Finn"-Kollegen) bei Twains Jim ähnlich vorgegangen sind. Ein einziges Mal haben Stingl und das Lektorat versagt: als der bis dahin stets als "Herzog" bezeichnete Gauner plötzlich als "Duke" apostrophiert wird. Aber sonst entspricht die Übersetzung genau Everetts Absicht: Anklang ans Vorbild von Twain.
Umso schockierender sind in dieser Jugendbuchstimmung dann die Gewalteinbrüche. Was Twain von der jugendlichen Naivität seines Ich-Erzählers verkennen lässt, die blutige Brutalität einer Sklavenhaltergesellschaft, das erkennt der wissensbegierige Jim in "James" umso deutlicher. In der Bibliothek von Richter Thatcher hat er Voltaire und John Locke gelesen, und in seinen Träumen führt er mit ihnen Gespräche, die nicht eben schmeichelhaft für die Klassiker ausgehen.
Jim und seine schwarzen Leidensgenossen erfreuen sich auch ihrer kaschierten Überlegenheit, wenn sie wieder einmal einen Weißen getäuscht haben: "'Jetzt wird er sich betrinken, nicht so sehr, weil er's kann, sondern weil wir es nicht können', sagte ich. Luke schmunzelte. 'Und wenn wir ihn dann später herumtorkeln und sich zum Narren machen sehen, ist das dann ein Beispiel von proleptischer oder von dramatischer Ironie?' 'Könnte beides sein.' 'Das wäre dann wirklich ironisch.'" Nein, witziger und dabei böser ist die amerikanische Gegenwartsliteratur lange nicht gewesen. Womöglich nicht mehr seit Mark Twain.
Besonders interessant wird es, wenn Everett sich inhaltlich von "Huckleberry Finn" löst. Im Gegensatz zur Handlung bei Twain ist die von "James" zeitlich klar situiert: im Jahr 1861, rund um den Ausbruch des Bürgerkriegs - auch das eine Zuspitzung der politischen Konnotation des Geschehens. Und Everett erzählt in "James" nicht nur Jims Geschichte neu. Dadurch, dass die Figuren von Twain bei ihm zu anderen Menschen werden, wird unsere Welt eine andere. Das ist das Gegenmodell zur Bereinigung von Klassikern wie Michael Endes "Jim Knopf"-Bücher: Bereicherung der Literatur. Natürlich ist das nichts für identitäre Eiferer; nicht umsonst ist "Ironie" ein von Everetts Jim so oft gebrauchtes Wort. Als der gegenüber Huck noch den dummen Neger spielt, stellt er einmal fest: "Da sin die Leute ehm komisch. Die nehm die Lühng, die sie hahm wollen, und schmeißen die Wahrheiten weg, die ihn Angs machng." Auch aktueller ist die amerikanische Gegenwartsliteratur lange nicht gewesen als mit "James" in diesem Wahljahr.
Percival Everett: "James". Roman.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Hanser Verlag, München 2024. 336 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Es ist ein Sprachfeuerwerk und ein überaus kluges Buch. So geht Weltliteratur." Denis Scheck, WDR, 31.03.24 "Eine fesselnde Antwort auf Mark Twains Klassiker 'Huckleberry Finn'... Eine literarische Sensation." Jury Booker Prize zur Longlist-Nominierung, 30.07.24 "Witziger und dabei böser ist die amerikanische Gegenwartsliteratur lange nicht gewesen. Womöglich nicht mehr seit Mark Twain." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.03.24 "Eine literarische Auseinandersetzung mit dem Rassismus, wie es sie noch nicht gab." Martin Ebel, Tages-Anzeiger, 25.03.24 "Man kann sich vorstellen, dass diese Story alles bereithält, was ein furioser Abenteuerroman braucht: Spannung und Wendungsreichtum, Cleverness und Gefühl, mithin einen eingängigen und dadurch packenden Stil. Doch zur Brillanz des Textes trägt darüber hinaus seine analytische Intelligenz bei." Björn Hayer, Der Freitag, 21.03.24 "Mit 'James' revidiert Everett den amerikanischen Kanon auf subversive Weise und schafft dabei großartige Literatur. Sein kraftvoller Erzählfluss trägt die Tiefenschichten philosophischer Reflexion in sich, aber der Leser kann auch an der Oberfläche bleiben und sich von den überraschenden Wendungen der Geschichte mitreißen lassen." Martina Läubli, Neue Zürcher Zeitung, 16.03.24 "Ein meisterhaft komponierter, exzellent geschriebener, die twainsche Utopie weiterdenkender Roman... Eine grandios gebaute, satirische, anrührende, höchst unterhaltsame Abenteuergeschichte... Absolut zeitgenössisch, radikal, inspirierend." Ulrich Rüdenauer, SWR lesenswert, 17.03.24 "Eine Abenteuergeschichte, die scharfzüngig und humorvoll strukturellem Rassismus die Stirn bietet." SRF-Bestenliste April, 28.03.24 "Ein sprachliches Kunstwerk." Gerrit Bartels, Tagesspiegel, 01.08.24 "Ein wunderbar unterhaltsamer, in jede Nuance sprachbewusster Roman." Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau, 01.06.24 "Eine rundum bereichernde Lektüre!" Das Magazin, Juni 2024