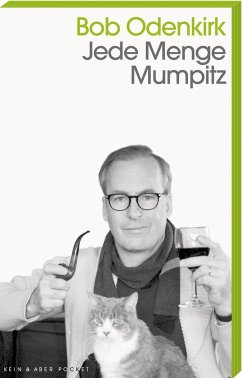Die Serie "Better Call Saul" ist der Höhepunkt der Karriere des Schauspielers Bob Odenkirk. Jetzt läuft die letzte Staffel - und die Zeichen mehren sich, dass damit eine Epoche zu Ende geht
Jede Menge Mumpitz" lautet der deutsche Titel von Bob Odenkirks Buch "A Load of Hooey". Man wünschte sich eine weniger freie Übersetzung. Denn die Witzsammlung "A Load of Hooey" ist ganz buchstäblich eine Ladung Quatsch. Es ist eines dieser Bücher, dessen Einband Pressezitate unbekannter Provinzblätter zieren: "Spoiler: dieses Buch ist lustig" ("Local IQ", Albuquerque). Spannend wird dieser Mumpitz erst durch die Prominenz seines Autors: Bob Odenkirk ist einer der erfolgreichsten Seriendarsteller der letzten Jahre. Auf dem Cover der deutschen Ausgabe sitzt er einsam auf einem Rinnstein. Er trägt zum Anzug eine mit silberfarbenen Drachen bedruckte Krawatte, einen Siegelring am kleinen Finger und hält eine Eistüte in der Hand. Sein Blick ist resigniert, melancholisch. Der Mann auf diesem Foto, so wird man den Eindruck nicht los, ist nicht Bob Odenkirk, sondern dessen Paraderolle, Jimmy McGill aus der Serie "Better Call Saul". Tatsächlich stammt das Foto von AMC, dem Sender, der die Serie produziert. Ein verkaufsstrategisches Täuschungsmanöver, denn Odenkirks Mumpitz-Buch hat mit der Serie nichts zu tun. Und genau damit ein Sinnbild. Weniger für Odenkirk als für die Branche des seriellen Erzählens, die gerade, ganz wie der Anwalt aus der Serie, Ausverkauf betreibt.
"Better Call Saul" war ein Trojanisches Pferd. Dass eine solche Serie überhaupt in das hermetische Bollwerk der monumentalen amerikanischen Serien geschoben werden konnte, war ein glücklicher Betriebsunfall, die Ausnahme von der Ausnahme. Nach den Einbrüchen an den Kinokassen im letzten Jahrzehnt war es das Fernsehen, das mit seinen Serien erzählerisch neue Wege ging, auf weniger Action dafür ein Erzählen in die Breite setzte. Ein Erzählen, das ganzen Milieus Konturen zu verleihen wusste und andere Helden hervorbrachte. Außenseiter und Verlierer rückten in den Fokus. Die moralische Verfallsgeschichte "Breaking Bad", in der ein krebskranker Chemielehrer Drogen produziert, galt als ein Musterbeispiel.
Mit "Better Call Saul" erhielt der größte Loser aus "Breaking Bad", der skurrile wie korrupte Anwalt Saul Goodman, 2014 ein eigenes Spin-off. Es behandelt dessen Vorgeschichte in Form einer ganz langsamen Metamorphose vom Idealisten zum korrumpierten Rechtsverdreher. Überraschenderweise kam dabei viel mehr heraus als nur eine charmante Charakterstudie einer beliebten Nebenfigur. Bemerkenswert ist etwa, wie die Macher die Figur des Anwalts thematisieren: Der Anwalt, der in amerikanischen Serien sonst seinen Anzug wie eine glänzende Rüstung trägt und mit Ritterlichkeit die Ethik des Rechts verteidigt, ist eine Schlüsselfigur im amerikanischen Selbstverständnis. Denn in ihm treffen mit der Kunstform der Rhetorik, also des überzeugenden Redens, und der Kunst des Deals zwei Grundtugenden aufeinander. Jimmy McGill zerreibt den Idealtypus dieser Figur und degeneriert darüber zu Saul Goodman, ihrem Zerrspiegel. Nun ist die Geschichte eines hintertriebenen Anwalts nicht neu. Neu war aber die Form. Nicht nur schlug die Serie viel leisere Töne an, sondern sie erzählte im Gegensatz zu "Breaking Bad", wo die moralische Erosion der Protagonisten über eine Reihe traumatischer Ereignisse funktioniert, diesen Verfall als eine Funktion der Zeit. McGill entscheidet sich mehrmals für das Richtige, und trotzdem zerbröselt seine Integrität in der Sanduhr alltäglicher Demütigungen.
Die größte Sensation von "Better Call Saul" ist dabei der Umgang der Serie mit der Zeit, ein Mut zur Langsamkeit, der selbst für die Verhältnisse der zeitgenössischen Fernsehromane enorm ist. Ein eindrückliches Beispiel findet sich in der aktuellen Folge ("Eine wilde Fahrt"). Es soll ein großes Drogenlabor gebaut werden, jenes Labor, in dem Walter White in "Breaking Bad" sein legendäres blaues Crystal Meth mischen wird. In "Breaking Bad" ist dieser geheime Hightech-Bunker unter einer Wäscherei einfach da. Mit einer Geste der Selbstverständlichkeit übergibt Mafiaboss Fring Walter White die Schlüssel. In "Better Call Saul" wird dieses Einfach-da-Sein thematisiert. Ein französischer Ingenieur landet in Albuquerque, fährt zu einer Kilometermarkierung auf einer abgelegenen Landstraße, wird instruiert, sich einen Sack über den Kopf zu ziehen, sitzt sehr lange im Rückraum eines Vans, erreicht endlich die Wäscherei, vermisst die Räumlichkeiten und erklärt schließlich, wie lange so ein geheimer Umbau dauern würde. Doch Fring lehnt das Angebot ab. Ein zweiter Ingenieur wird eingeflogen. Diesmal ein Deutscher. Dasselbe Spiel, nur noch gründlicher. Erst dann wird das Projekt abgesegnet. Das ist sehr viel Zeit innerhalb der Erzähl-Ökonomie einer Episode, um zu sagen: Ein Laborbau ist schwierig.
Davon handelt eine Hälfte dieser Folge. Es passiert wenig, und doch wird unser Auge auf das gelenkt, was wir durch unsere Sehgewohnheiten als selbstverständlich hinzunehmen gewohnt sind. Um den Blick für Details zu schärfen, dauert alles in "Better Call Saul" seine Zeit. Immer wieder warten die Helden, langweilen sich, werden ungeduldig. Diese Art des Erzählens erinnert an das, was der Kinotheoretiker Gilles Deleuze als Zeitbild beschrieben hat. Hier fällt nicht ein wichtiges Ereignis ins nächste, sondern, wie im wirklichen Leben, liegt die eigentliche Herausforderung im Meistern der Zwischenzeit. Dass einem dabei beim Zusehen nie langweilig wird, liegt daran, dass "Better Call Saul" diese von der Zeit her gedachte Erzählweise geschickt mit Mafia- und Heist-Motiven kombiniert. Als ginge das Drehbuch auf eine Kollaboration von Michelangelo Antonioni und Martin Scorsese zurück.
Als "Better Call Saul" 2014 anlief, hatte Odenkirk große Zweifel am Erfolg der Serie. Schließlich handelte es sich, statt der erwarteten Anwaltssatire, um eine ernst dahinschleichende Charakterstudie, um das Scheitern eines American Dream an der Banalität der Wirklichkeit. Diese Nervosität war mehr als Koketterie. Denn "Better Call Saul" war auch für Odenkirk selbst die letzte Chance, sich seinen persönlichen Traum von Hollywood noch zu erfüllen. Seine Karriere war bis dahin durchwachsen. In den späten Achtzigern begann er als Gag-Schreiber für "Saturday Night Life", später für die Ben-Stiller-Show, in der er auch vor der Kamera stand. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte er Mitte der Neunziger, als er zusammen mit David Cross drei Staffeln lang eine eigene Sketch-Sendung hatte. Daneben Schreibarbeiten und sporadische Gastauftritte in Fernsehserien wie "Roseanne". Auch in "Breaking Bad" sollte Odenkirk nur eine Nebenrolle übernehmen. Seine abgehalfterte Performance kam aber so gut an, dass ihm die Macher Vince Gilligan und Peter Gould größere Parts schrieben, bis er am Ende der Serie zu einer Schlüsselfigur avancierte. Odenkirk, der sich immer als Comedian und nie als Schauspieler verstand, war da bereits fünfzig und überrascht von diesem späten Erfolg. Dabei ist es genau jenes Unwohlsein darüber, in der Welt angekommen zu sein, die einen nie wirklich haben wollte, die Odenkirk so prädestinierte für die Rolle Jimmy McGills. Hierin gründet dieser traurig-trotzige Blick des Aufschneiders sowie diese melancholische Aura des Slapsticks, die all sein Tun begleiten.
Das war 2014. Seitdem ist die Euphorie um das serielle Erzählen einem Hype gewichen. Es gibt Lehrstühle dafür an den Filmhochschulen, kaum ein Treatment verzichtet mehr auf den Begriff "horizontal". Doch in dem Grad, wie die Menge an Serien zunimmt, werden die Produktionen konventioneller. Auf den Streaming-Portalen zeichnet sich eine stetige programmatische Annäherung an das Trash-TV der Neunziger ab. Auf Netflix laufen Superhelden-Serien und romantische Komödien, Food- und Crime- und andere Lifestyle-Dokus fluten den Markt, selbst die einst konsequent dystopische Serie "Black Mirror" versöhnt mit Happy Endings.
Da passt das Erscheinen von Bob Odenkirks Mumpitz-Buch ins Bild. Die Übersetzung einer vier Jahre alten, erratischen Anthologie aus schalen Gags, die an den Humor anknüpfen, mit dem Odenkirk vor zwanzig Jahren gescheitert ist. Alles muss raus, bevor auch die Figur des Saul Goodman vergessen ist. Im besten Fall, so prophezeite Saul Goodman am Ende von "Breaking Bad", könne er noch als Manager einer "Cinnabon"-Filiale in Omaha arbeiten. Es wäre traurig, wenn Bob Odenkirk ein ähnliches Schicksal ereilt.
MAXIMILIAN SIPPENAUER
Bob Odenkirk: "Jede Menge Mumpitz". Kein & Aber, 176 Seiten, 12 Euro. "Better Call Saul" läuft auf Netflix.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main