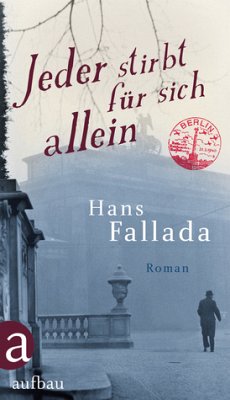Ein einzigartiges Panorama des Berliner Lebens in der Nazizeit: Hans Falladas eindrückliche und berührende Darstellung des Widerstands der kleinen Leute avanciert rund sechzig Jahre nach der Entstehung zum internationalen Publikumserfolg. Jetzt erscheint erstmals die ungekürzte Fassung nach dem bislang unveröffentlichten Originalmanuskript. Ein Berliner Ehepaar wagte einen aussichtslosen Widerstand gegen die Nazis und wurde 1943 hingerichtet. Von ihrem Schicksal erfuhr Hans Fallada aus einer Gestapo-Akte, die ihm durch den Dichter und späteren Kulturminister Johannes R. Becher in die Hände kam. Fieberhaft schrieb Fallada daraufhin im Herbst 1946 in weniger als vier Wochen seinen letzten Roman nieder und schuf ein Panorama des Lebens der normalen Leute im Berlin der Nazizeit: Nachdem ihr Sohn in Hitlers Krieg gefallen ist, wollen Anna und Otto Quangel Zeichen des Widerstands setzen. Sie schreiben Botschaften auf Karten und verteilen sie in der Stadt. Die stillen, nüchternen Eheleute träumen von einem weitreichenden Erfolg und ahnen nicht, dass Kommissar Escherich ihnen längst auf der Spur ist. Diese Neuausgabe präsentiert Falladas letzten Roman erstmals in der ungekürzten Originalfassung und zeigt ihn rauer, intensiver, authentischer. Ergänzt wird der Text durch ein Nachwort, Glossar und Dokumente zum zeithistorischen Kontext.

Befreit vom Grundrauschen der Moral und der Ideologie: Hans Falladas "Jeder stirbt für sich allein"
Fallada, das ist die Heiterkeit seines Romans, hat den Glauben, dass selbst der Deutsche ein freier Mensch sei. Frei genug, den Führer als Mörder zu beschimpfen. Frei genug, dafür mit dem Leben zu bezahlen.
Unter all den Fragen, die irgendwann im Raum stehen, wenn man darin alleine ist mit einem Werk der Kunst, ist diese hier die erste und die simpelste; und sie klingt so unendlich naiv, dass die Kenner und die Kritiker sich selten trauen, diese Frage einfach mal zu stellen:
Was wollte uns der Autor eigentlich sagen mit seinem Werk? Was wollte Hans Fallada seinen Lesern sagen mit dem Roman "Jeder stirbt für sich allein", siebenhundert Seiten dick, 1947 geschrieben und in diesem Frühjahr in einer ungekürzten Fassung wiederaufgelegt?
Es spricht nicht gegen Hans Fallada und schon gar nicht gegen sein Buch, dass die Antwort nicht versteckt und kaum verschlüsselt ist; dass sie in jedem Kapitel gut lesbar hingeschrieben und vom Personal dieses Buchs sehr anschaulich durch dessen Taten und Unterlassungen belegt wird. Die Antwort läuft darauf hinaus, dass es, damit die Herrschaft der Nazis zwölf Jahre dauern konnte, nicht bloß eine verschworene Clique von Verbrechern an der Spitze des Staates und seiner Institutionen brauchte. Sondern dass diese Herrschaft sich nicht hätte halten können, wenn nicht viel zu viele Deutsche so korrupt und verroht gewesen wären, amoralisch und brutal genug, aus den Verbrechen des Regimes noch ihren Profit zu schlagen. Und sie hätte sich erst recht nicht halten können, wenn nicht noch viel mehr Deutsche, recht eigentlich die große Mehrheit, zu ängstlich und zu feige gewesen wären, sich zu wehren gegen diese Amoral. Vor allem aber läuft die Antwort darauf hinaus, dass es einige gab, die eben doch widerstanden, einfache Leute, Arbeiter wie Anna und Otto Quangel, die, nicht belesen und kaum gebildet, doch kein Freisemester brauchten, um zu erkennen, wie falsch das alles war, was in Deutschland geschah. Und die, als sie dann gefasst und gefangen waren, den Hass der Mehrheit dafür bekamen, dass sie die Entschuldigung der Feigen und der Ängstlichen, "man" habe doch nichts tun können, als sich zu ducken und zu gehorchen, durch ihre Taten dementierten.
Wer jetzt erwidern möchte, dass all diese Aussagen bekannt und außerdem trivial seien; dass man also keine siebenhundert Seiten lesen müsse, um sich noch einmal vor Augen zu führen, wie das sogenannte Dritte Reich funktionierte und warum: Der soll doch bitte noch einmal kurz das Meinungsbild der vergangenen vier, fünf Jahre genau betrachten, all die Bücher und Artikel, die Podiumsdiskussionen und feierlichen Reden, welche, alles in allem, eher die These stützten, dass die Nazis, weil sie Pöbel waren, nur die Arbeiter und die Kleinbürger hätten beeindrucken können. Den feineren Leuten seien die Nazis zu vulgär gewesen, und der Adel war ja angeblich nicht in der SS. Sondern im Widerstand.
Was Hans Fallada uns sagen will mit diesem Buch, das kann man also auch heute gar nicht oft und laut genug sagen - aber noch viel interessanter ist die Frage, was alles Fallada uns nicht sagen wollte mit diesem Buch. Was steht also da drin, was nicht vom Autor intendiert ist, was spricht der Text, wenn Fallada schweigt?
Man muss wohl, um allen Antwortversuchen eine halbwegs solide Grundlage zu geben, noch einmal kurz skizzieren, wann dieses Buch entstand, wer der Mann war, der es geschrieben hat, und wie es dem Autor und dem Text dann erging. Fallada war damals ein Versehrter, ein Mann, der mit zu vielen Drogen zu viele Probleme hatte, sich einer Entziehungskur anscheinend einigermaßen erfolgreich unterzog. Und dann setzte er sich hin und schrieb, wie es heißt, das Manuskript (das eine wahre Geschichte als Grundlage hatte) in einem Monat; drei Monate später starb, gerade 53-jährig, Hans Fallada, und im sozialistischen Aufbau-Verlag setzten sie sich daran, die schönsten Ambivalenzen und die vehementesten Widersprüche aus dem Text zu streichen, damit der Aufbau des Sozialismus nicht durch zu anspruchsvolle Lektüre gefährdet werde.
Wir lesen heute also einen ganz anderen Text - was aber nicht nur an den wiederhergestellten Textpassagen liegt, den Widersprüchen, die jetzt zugelassen sind: Es liegt vor allem an uns, die wir so anders sind und anders leben als die Leute, für die Fallada diesen Text geschrieben hat. Es liegt an der Zeit, an den siebzig Jahren, die vergangen sind seit dem, was die Gegenwart dieses Textes ist. Wer sehr schnell und sehr viel schreibt (und dabei nicht nur die vorgeformten Textbausteine des Trivialen aufeinanderschichtet), der muss (wie Rainald Goetz das einmal nannte) zum Weltempfänger werden; der hat gar nicht die Chance, all das, was ihm so an Erfahrung, Anschauung, Empirie zur Verfügung steht, so lange zu formen, zu kneten und zu bearbeiten, bis sich noch das letzte Detail der schriftstellerischen Absicht unterworfen hat.
Das ist der Grund, warum es, nur zum Beispiel, solch ein Vergnügen macht, Balzacs Romane gegen die Intentionen ihres Autors zu lesen. Und das ist das Wunder von "Jeder stirbt für sich allein": dass sich diese Prosa häufig so liest, als ob Fallada nicht bloß Autor wäre, sondern zugleich das Medium, das Empfangsgerät, durch welches die Stimmen jener Jahre manchmal ganz direkt, ungefiltert und ohne das Grundrauschen einer moralischen oder ideologischen Absicht zu uns zu sprechen scheinen.
Es ist viel Poesie in diesem Buch, das doch so nüchtern geschrieben ist, es ist eine Poesie, die daher kommt, dass aus dem Abstand, den die siebzig Jahre schaffen, die Formen deutlicher sichtbar werden: die Form der Sprache und die Formen der Verhältnisse, welche diese Sprache beschreibt. Das war nicht zu haben für die Leser der Erstausgabe, denen die Handlung und die Personen als längst nicht abgeschlossene Fastgegenwart oder Jüngstvergangenheit erscheinen mussten - und für uns heute fängt das schon mit dem Schauplatz an, der Jablonskistraße am Prenzlauer Berg, wo die Quangels wohnen, den Vierteln zwischen der Prenzlauer Allee und dem Friedrichshain, einer Gegend also, die fast jeder, der Berlin besucht hat, als frischgestrichen und von halbwegs gutverdienenden Grünenwählern bevölkert vor Augen hat. In der Doppelbelichtung, die bei der Lektüre Falladas entsteht, sieht man dann im Souterrain des Hinterhauses, wo eben der Yogakurs für schicke Anfangsvierziger zu Ende ging, plötzlich den kleinen Spitzel mit seiner Frau, der Gelegenheitsprostituierten, und fünf Kindern auf fünfzig Quadratmetern und im physischen und seelischen Elend hausen. Was, selbst wenn man weder das eine noch das andere sympathisch findet, doch dem Schauplatz die Tiefe und der Beschreibung einen Zauber verleiht.
Am Anfang spürt man fast eine Sehnsucht nach der Sprache dieser Leute, einem Deutsch, das noch nicht cool und selten ironisch klingt, nach Sätzen, die wärmer und kraftvoller zu wirken scheinen als die, die wir einander heute sagen - und dann erschrickt man beim Lesen umso mehr, wenn in der nächsten Szene schon anschaulich wird, dass genau dieses Deutsch das Medium des Verrats, der Denunziation und der abscheulichsten Beschimpfungen wird: Dass Wörter wie "verrecken" und "Judensau" kaum noch gebräuchlich sind, muss man nicht bedauern. Und so geht es einem mit so vielem, was Fallada ganz lakonisch beschreibt: Man spürt eine Verführung, die von den Menschen, den Schauplätzen, den scheinbar so stabilen Verhältnissen ausgeht. Und erfährt doch zwei Seiten später wieder, dass, während die Häuser der Stadt noch stehen, von der Moral nur noch Trümmer und Ruinen übrig sind. Und es gehört eher zu den Stärken dieses Textes, als dass man es als Mangel empfände, wenn man, angesichts der sich immer heftiger steigernden Brutalität, die, wenn am Schluss beide Quangels und ein paar Menschen mehr im Gefängnis ihren Folterern gegenüberstehen, fast schon eine Splatter-Prosa erzwingt - wenn man also bei dieser zutiefst beunruhigenden Lektüre niemals eine gesicherte Erkenntnis darüber bekommt, ob diese Totalverrohung tatsächlich eine Wirkung der Naziherrschaft war. Oder eine der Ursachen.
Man kann, weil er so spannend ist, den Roman fast so schnell und atemlos lesen, wie er geschrieben ist. Man kann ihn aber, in einem Moment der Besinnlichkeit, auch beiseitelegen und noch einmal nachschauen, was im "Doktor Faustus" steht, jenem Roman, den Thomas Mann fast zur selben Zeit abgeschlossen hat, weit weg von Berlin, in Kalifornien, und der doch nicht so sehr das Gegenteil von Falladas Roman ist, sondern dessen Komplement, eine Tiefenbohrung in unsere Geistesgeschichte, und ganz unten findet Thomas Mann die Frage, ob, was 1945 zur Hölle fuhr, schon mit Martin Luther oder noch früher begonnen habe.
Fallada, das ist die grundsätzliche Heiterkeit seines Romans, hat den Glauben, dass selbst der Deutsche ein freier Mensch sei. Frei von den Fesseln seiner Herkunft und Geschichte. Frei genug, Postkarten zu schreiben, auf denen der Führer als Mörder beschimpft wird. Frei genug, dafür mit dem Leben zu bezahlen. Uns Lesern bleibt die Freiheit zu entscheiden, ob wir uns erschrecken oder freuen sollen über diesen Text: Erschrecken darüber, wie nah das alles ist. Oder uns freuen daran, wie es sich mit jedem Tag entfernt.
CLAUDIUS SEIDL
Hans Fallada: "Jeder stirbt für sich allein". Aufbau-Verlag, 700 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Monatelang stand Hans Falladas Roman auf den internationalen Bestsellerlisten, bis er auch hierzulande wieder zum großen Verkaufserfolg wurde. Adam Soboczynski reibt sich verwundert die Augen: Dieser "verblüffend schlechte Roman"? Fallada, der sich durch die NS-Zeit als Mitglied der Reichsschrifttumkammer und schwer drogenabhängig schleppte, hat ihn 1945 innerhalb weniger Wochen verfasst, kurz darauf starb er. Er erzählt darin von einem Arbeiterehepaar, das nach dem Tod seines Sohns an der Front beginnt, regimekritische Flugblätter zu verteilen, und von der Gestapo gejagt und gefangen wird. Nach literarischen Gesichtspunkten taugt der Roman in Soboczynskis Augen nicht viel: Die Charaktere sind völlig unplausibel, die unglaubwürdigsten Begebenheiten werden "herbeierzählt", alles wird behauptet, nichts beschrieben. Was das Buch dann aber für den Rezensenten zum "großartigen Roman" macht, ist seine Sicht auf die Deutschen. Nicht ideologisch angetrieben erscheinen sie hier, sondern von blanker Gier. Was Soboczynski beeindruckt, sind die von Fallada geschilderte "alltägliche Bestialität" und das nachbarliche Denunziantentum. Hier sei nicht die Frage, was die Deutschen von Auschwitz wussten, meint Soboczynski, sondern wie sie mit ihrem Nachbarn im dritten Stock umgingen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH