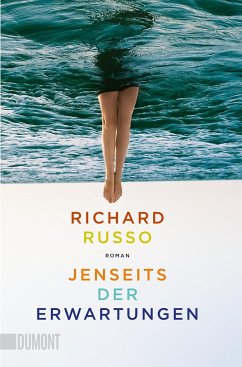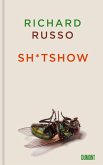An einem Spätsommertag auf Martha's Vineyard treffen sie sich wieder: Lincoln, Teddy und Mickey. Die drei Männer planen, das Wochenende in einem Ferienhaus auf der Insel zu verbringen - um der alten Zeiten willen. Seit dem Studium während der Vietnamkriegsjahre sind sie miteinander befreundet. Sie sind sehr unterschiedliche Wege gegangen, doch alle waren sie einst in dasselbe Mädchen verliebt, Jacy Calloway. Kurz nach ihrem Abschluss verschwand Jacy spurlos. Aber keiner von ihnen hat die Freundin vergessen - oder die Frage, wen von ihnen Jacy eigentlich geliebt hat. Schließlich beginnt Lincoln, sich erneut mit den Umständen ihres rätselhaften Verschwindens zu beschäftigen. Was ist damals wirklich passiert? Richard Russo erzählt von drei Menschen, die sich fremd geworden sind, und vom Umgang mit der Unsicherheit, ob die eigenen Lebensentscheidungen die richtigen waren. Wie nebenbei ergibt sich daraus das Porträt eines Landes, das sich selbst nicht mehr ganz versteht. Mit 'Jenseitsder Erwartungen' zeigt Russo seine ganze Meisterschaft - als großer Erzähler und als Menschenkenner.
»Ist einfach: toll!« Katharina Kluin, STERN »Große Literatur« Martin Ebel, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Den Dreiklang aus Vergangenheit, Gegenwart und vager Zukunft beherrscht Richard Russo.« Philipp Haibach, ROLLING STONE »Russo verknüpft alle drei Leben miteinander und zeigt wieder einmal meisterhaft, dass die Dinge oft sehr anders verlaufen als man sie plant. [...] Höchst spannende Unterhaltung!« Elke Heidenreich, WDR 4 »Hierzulande eine Art Geheimtipp« Meike Schnitzler, BRIGITTE FERIEN »Ja, der Roman ist auch eine Bestandsaufnahme der Gefühle alter weißer Männer. Das aber kann Russo wie kein anderer!« Meike Schnitzler, BRIGITTE »Ein großartig komponierter Roman von Richard Russo. Ich beneide jeden, der ihn noch nicht gelesen hat« Annemarie Stoltenberg, NDR GEMISCHTES DOPPEL »'Jenseits der Erwartungen' beschert eine zunächst gemütliche Lektüre, dann nimmt die Geschichte [...] richtig Fahrt auf, zuletzt macht sie regelrecht atemlos.« Katja Lückert, DEUTSCHLLANDFUNK Büchermarkt »Richard Russo gelingt ein hinreißendes Porträt einer Generation [...] [Er] hat sich [...] längst in der Reihe der großen Erzähler der - weißen - Seele Amerikas etabliert. Sein jüngster Wurf bestätigt diesen Ruf auf glanzvolle Weise.« Thomas Vieregge, DIE PRESSE »Der brillante amerikanische Erzähler Richard Russo folgt den Figuren, liebend und lebensklug.« Peter Pisa, KURIER »Beste Unterhaltung mit Krimifaktor. [...] [Richard Russo] ist ein Stephen King ohne Horror, was das amerikanische Kleinstadtleben und deren präzise Darstellung betrifft.« Christoph Schröder, SWR2 Lesenswert »Ein intensives Buch, voll leiser Melancholie« Sophia Feldmer, FREUNDIN »Grosse Literatur. Und wenn sich die reformierte schwedische Akademie endlich einmal zu einem US-Amerikaner durchringen kann: Richard Russo wäre ein valabler Nobelpreisträger.« Martin Ebel, TAGES-ANZEIGER »Russo schreibt [in 'Jenseits der Erwartungen'] das Porträt seiner Generation« Martina Sulner, REDAKTIONSNETZWERK DEUTSCHLAND »Eine großartige Geschichte über die Freundschaft« Rainer Hartmann, SWR1 »Man will [Richard Russos] Bücher einfach immer wieder lesen« Christoph Schröder, DER TAGESSPIEGEL »Geradezu atemlos« Katja Lückert, NDR KULTUR »Spannend und leichtfüßig erzählt« Suse Schröder, CHECKPOINT-NEWSLETTER vom TAGESSPIEGEL »Richard Russo ist ein großer Könner, und er ist längst in die Lücke gestoßen, die John Updicke und James Salter hinterlassen haben.« Udo Schöpfer, RHEINPFALZ »Was nach Kriminalroman klingt, ist tatsächlich ein kluges Porträt einer gespaltenen Gesellschaft, angesiedelt in der Zeit kurz vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.« Uwe Grosser, HEILBRONNER STIMME »Ein Plot wie maßgeschneidert für die Strandlektüre« DIE PRESSE »Der brillante amerikanische Erzähler Richard Russo folgt den Figuren, liebend und lebensklug.« Peter Pisa, KURIER »Richard Russo ist einer der besten literarischen Chronisten des heutigen Amerika.« Gerold Renoni, SALVE »Meisterhafter Roman über das gegenwärtige Amerika - und wie es so werden konnte, wie es jetzt ist.« HÖRZU »Russo [ist] der glänzende Porträtist amerikanischer Kleinstadtwelten« Thomas Andre, HAMBURGER ABENDBLATT »Ich halte Richard Russo für einen großartigen Autor.« Thomas Andre, NEXT BOOK PLEASE »Wie Russo drei Leben miteinander verwebt und in ständigem Wechsel zwischen Gegenwart und Rückblenden aufblättert, ist große Kunst. [Er bleibt] ganz nah und höchst liebevoll bei seinen Figuren. [...] Ein zutiefst menschliches Buch.« Christian Hümmeler, KÖLNER STADT-ANZEIGER »Eine mitreißende Lektüre« Iris Hetscher, WESER KURIER »Ein Meisterwerk« Welf Grombacher, FREIE PRESSE »Richard Russos Roman 'Jenseits der Erwartungen' erzählt eine so spannende wie symptomatische Geschichte aus den USA.« Judith von Sternburg, FRANKFURTER RUNDSCHAU »Ein überdurchschnittlicher guter Roman« Andreas Schröter, RUHR NACHRICHTEN »Pulitzer-Preisträger Richard Russo begegnet seinen drei Figuren mit feinironischem Mitgefühl, zugleich schürt er die Spannung, indem er die Brüche, die Unstimmigkeiten seiner Charaktere ausleuchtet. Eine Strand-Lektüre mit hohem Anspruch.« Britta Heidemann, WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE »In Persona prallen hier die Erblasten der Vergangenheit und die sich rasant verändernde Zukunft aufeinander.« Oliver Schulz, NORDWEST-ZEITUNG »Das Buch entwickelt einen Sog, dessen Kraft nachwirkt - weit über die Sommerlektüre hinaus.« PFORZHEIMER ZEITUNG »Ein großartiges Meisterwerk, das mit glänzender Prosa und psychologischer Tiefenschärfe das realistische Bild einer ganzen Generation zeichnet.« Wolfgang A. Niemann, WILHELMSHAVENER ZEITUNG »Russo [...] schreibt das Porträt seiner Generation - und beschreibt eine gespaltene Gesellschaft.« Martina Sulner, HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG »Mit 'Jenseits der Erwartungen' hat Richard Russo einen weiteren so tiefgründigen wie hoch unterhaltsamen Roman vorgelegt. « Bernadette Conrad, ST. GALLER TAGBLATT »Wie nebenbei ergibt sich daraus das Porträt eines Landes, das sich selbst nicht mehr ganz versteht.« Manuela Kuebler-Schubert, SOESTER ANZEIGER »Unbedingt lesen!« Welf Grombacher, SCHWÄBISCHE ZEITUNG »Alte weiße Männer unter sich [...] Bei dem amerikanischen Autor Richard Russo wird daraus sogar ein spannendes Thema.« Andreas Frane, NÜRNBERGER NACHRICHTEN »Brillant erzählt, weise und klug.« Werner Krause, KLEINE ZEITUNG »Einmal mehr beeindruckt Richard Russo mit psychologischem Gespür und feinem Humor.« Martin Oehlen, BÜCHERATLAS