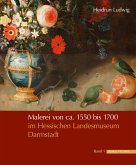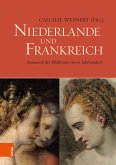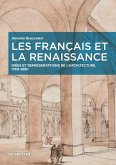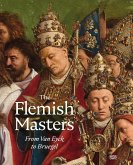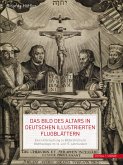Erstmals legt Nadine Mai zur Brügger "Jeruzalemkapel", einem der am besten erhaltenen Jerusalem-Ensembles und Stiftungskomplexe des europäischen Spätmittelalters, eine umfassende Studie vor. Im Zentrum ihrer Forschungen steht dabei nicht nur die Architektur dieser faszinierenden Kapelle, sondern auch ihre vielfältigen Funktionen sowie die noch kaum rezipierte Ausstattung mit Bildwerken, Reliquien und Epitaphen. Ausgehend von der Brügger Kapelle beschäftigt sich Mai dabei mit der Herstellung und Übertragung von Heiligen Orten um 1500 insgesamt und erarbeitet erstmals systematisch und zugleich differenziert einen breiten Zugang zu den im Kontext der Jerusalemrezeption zentralen monumentalen Darstellungsformen. Über die Auswertung teils noch unbeachteter Archivalien eröffnet die Arbeit zudem neue und spannende Einblicke in die Lebenswelt der Stifterfamilie Adornes und des an die Kapelle angeschlossenen Frauenstifts.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.