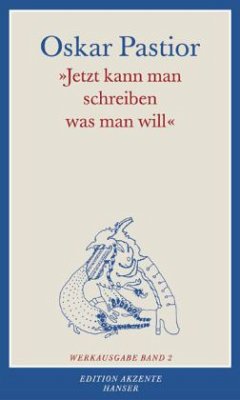Oskar Pastior gilt als einer der eigenwilligsten, produktivsten und sprachmächtigsten Dichter der deutschen Sprache. Zum ersten Mal seit vielen Jahren werden einige der wichtigsten Bücher von ihm wieder zugänglich und bilden den Auftakt zur großen Werkausgabe des Dichters. Versammelt sind die Gedichtbände von "Gedichtgedichte" bis "Fleischeslust" und "An die Neue Aubergine", die der Siebenbürger Pastior in den siebziger Jahren schrieb, nachdem er aus Rumänien in den Westen übergesiedelt war und seiner Produktivität keine ideologischen Grenzen mehr gesetzt wurden.

Zu den frühen Gedichten des Büchner-Preisträgers Oskar Pastior im Rahmen seiner Werkausgabe / Von Wulf Segebrecht
Die Befreiung von ideologischen Zwängen ist die Voraussetzung einer Befreiung der Sprache: An den frühen, bislang wenig bekannten Werken Oskar Pastiors ist zu erkennen, wie ein Dichter zu seinem Lebensthema findet.
Oskar Pastior, der Büchner-Preisträger dieses Jahres, ist der vertrackteste und naivste, der formstrengste und hintersinnig-heiterste, der übermütigste und sanfteste Poet deutscher Sprache der Gegenwart: ein tollkühner Sprachakrobat, ein witziger Wortzauberer, ein enthusiastischer Silbenstecher und lustvoller Letternliebhaber. Und er ist zu alledem ein hinreißender Vortragskünstler, der seine Zuhörer zu begeistern weiß für Gedichte, von denen sie, offen gesagt, kaum ein Wort verstehen und von denen sie trotzdem keine Silbe verpassen wollen. Wie erklärt sich das?
Seine Texte vermitteln dem Leser und Hörer die zunächst befremdliche Erfahrung einer Befreiung aus herkömmlichen Zuordnungszwängen der Grammatik und Semantik. Sie setzen ihn in Freiheit, und sie vermitteln ihm doch zugleich die Erfahrung des erneuten Gefesseltseins durch Bindungen, die jede "gebundene Rede" unausweichlich eingehen muß. Um eine Stellungnahme zum Thema "Gedichte schreiben heute" gebeten, hat Pastior ausgeführt: "bis in die syntax und grammatik hinein müßten gedichte doch helfen können, normatives denken aufzuweichen ... bis in die moleküle hinein müßten sie es wagen, selbst gegen vermeintlich populäre gebote der verständlichkeit, ihren text so irreduktibel zu spinnen - oder zu spannen - daß niemand ihn auf präsumptive ,kernaussagen' hin eindampfen oder verkürzt zitieren könnte (ungekürzt verschwiegen werden kann er eh immer)".
Geboren 1927, wuchs Pastior im rumänischen Hermannstadt auf, besuchte dort das deutschsprachige humanistische Brukenthal-Gymnasium und wurde 1945 als Siebzehnjähriger nach dem Einmarsch der Roten Armee zusammen mit Zehntausenden deutschsprachiger Rumänen in ein Lager im ukrainischen Donezbecken deportiert, wo er fünf Jahre lang Zwangsarbeit ableisten mußte. Drei weitere Jahre vergingen ihm im rumänischen Militärdienst, der es ihm immerhin ermöglichte, im Fernstudium das Abitur nachzuholen, so daß er seit 1955 das Studium der Germanistik an der Universität Bukarest aufnehmen konnte. Anschließend fand er eine Anstellung als Redakteur der Sendungen des Rumänischen Rundfunks für die deutschsprachige Minderheit. 1968 nutzte er eine sich bietende Gelegenheit zur Ausreise nach Deutschland, um hier endlich ein Leben als freier Schriftsteller wahrzunehmen: "ein großer Schritt für meine Menschheit", wie er diesen Entschluß heute kommentiert.
"Jetzt kann man schreiben was man will", heißt in diesem Sinne der zweite Band der Ausgabe der Werke Oskar Pastiors, die der Hanser Verlag seit 2003 herausgibt und von der nun drei Bände vorliegen. Der zweite Band dieser chronologisch angelegten Werkausgabe enthält die Texte seiner in Deutschland verfaßten Bücher der Jahre 1973 bis 1976: Die "Gedichtgedichte", "Höricht", "Fleischeslust" und "An die Neue Aubergine"; sie sind allesamt längst vergriffen. Erst beim Wiederlesen bemerkt man, daß seine Bücher zunehmend Projektcharakter besitzen: Sie präsentieren jeweils neu entwickelte Schreibverfahren, poetische Formen des Umgangs mit der Sprache, die er im Laufe der Zeit entwickelt und als "Kunstmaschinen" seriell erprobt hat. So bestehen die "Gedichtgedichte" aus Beschreibungen von Gedichten mit dem Gestus von Definitionen. Man kann da beispielsweise das Fröstelgedicht, das Lauftextgedicht, das Heimfrauengedicht, das Druckfehlergedicht (es ist "wahrscheinlich, daß sich beim druck eines druckfehlers ein druckfehler einschleicht") und Dutzende weiterer Gedichtarten näher kennen- und liebenlernen, wenn man keine Angst vor der verzweifelten Komik logischer Aporien oder vor surrealistischem Übermut hat. Pastior lehnt normsetzende Systeme ab, begehrt "gegen die Regelhaftigkeit selber" auf, wie er einmal bekannt hat. An die Stelle von Normregeln setzt er Spielregeln: "Wer nicht spielt, weiß nichts vom Widerstand."
Mit der Erfindung und Demonstration neuer widerständiger Spiele ist Pastior bis heute beschäftigt. Seine Anagrammgedichte und Wechselbälger, seine Palindrome, Gimpelstifte und Vokalisen, seine Sonetburger und Villanellen, seine Sestinen und Terzinen - um hier nur einige seiner Spiel-Projekte bei ihren Namen zu nennen - haben seine Bücher hervorgebracht und bevölkern sie. Nur den Beginn dieser fortgesetzten Spracharbeit, dieses andauernden Sprachspiels zeigt die Werkausgabe bisher vor, die mit ihrem dritten Band erst im Jahr 1980 angelangt ist, so daß für den Verleger, den Herausgeber, den Autor und für die Leser noch ein langer Atem erforderlich ist, bis sie in der Gegenwart ankommen.
Neues, ganz Unbekanntes allerdings bietet der eben erschienene erste Band der Werkausgabe. Er führt zurück zu Pastiors Anfängen. Denn schon in Rumänien war er seit 1960 mit Kinderbüchern, Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche und mit zwei eigenen Gedichtbänden in deutscher Sprache ("Offne Worte" und "Gedichte") hervorgetreten und dafür sogar mit ansehnlichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden. Diese Bücher hat man in Rumänien nach Pastiors Ausreise totgeschwiegen. Er selbst wurde in Abwesenheit wegen "Republikflucht" zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Und auch in Deutschland blieben diese Anfänge weitgehend unbekannt, ebenso wie der Band "namenaufgeben", der, als Pastior Rumänien verließ, bereits gedruckt war, aber nicht mehr erscheinen durfte.
Aus diesen drei Gedichtbänden bringt die Werkausgabe eine recht umfangreiche Auswahl, wobei der Herausgeber Ernest Wichner, selbst ein rumäniendeutscher Autor, aus seinem Unbehagen, ja seiner Ablehnung dieses Frühwerks kein Hehl macht; ihm hätte die Mitteilung genügt, schreibt er, "daß es diese Texte von Oskar Pastior gibt, ich würde sie in einer zu Lebzeiten des Dichters veranstalteten Werkausgabe, fehlten sie, nicht vermissen. Denn ich kann mir vorstellen, was es heißt, nach Jahrzehnten der Emanzipation aus fremdverschuldeter Unmündigkeit, sich mit Zeugnissen des eigenen Versagens und der damit verbundenen Demütigung konfrontiert zu sehen, und ich kann mir die daraus legitim abgeleitete Entscheidung vorstellen, all diesen Müll dem großen Vergessen zu überantworten."
Für einen Freund und Herausgeber sind das deutliche Worte. Aber Pastior hat sich dennoch anders entschieden, und das gewiß nicht, um den "Müll" zu konservieren. Vielmehr ist die kommentarlose Dokumentation des Tatsächlichen seine Antwort auf die Versuchung, in die zu Lebzeiten veranstaltete "Gesammelte Werke" ihre Autoren regelmäßig führen: Da wird allzuoft das vermeintlich weniger Gelungene im nachhinein geschönt und die Jugendsünden verschwiegen. Solchen Usancen und den daraus resultierenden Legenden und Enthüllungen tritt Pastior entgegen.
Vor allem wird so der Weg transparent und nachvollziehbar, den Pastior gegangen ist. In seinen Jugendgedichten unterwarf Pastior seine poetische Kunst den Gesetzen der Ideologie und der sozialistischen Parteilichkeit. Eine nur der Kunst eigene Freiheit, die sie nicht teilen muß mit den umlaufenden Sprachregelungen, konnte es unter diesen Umständen nicht geben. Die wahre Freiheit ist aber nicht schon mit der Abkehr von der ,Wahrheit' des Sozialismus oder mit dem Widerspruch gegen sie erreicht, solange sich die Dichtung noch in den gleichen sprachlichen und semantischen Grenzen bewegt, die auch politischen Parolen und Verlautbarungen eigen ist. Die Unfähigkeit, eine eigene Sprache zu finden, geht deutlich aus einem der frühen Gedichte aus dem Band "Offne Worte" (1965) hervor:
Woher soll ich die Vergleiche herholen,
zu übersetzen meine ganze spezifische
Freude
an den Leuten, die schön sind, weil sie
lernen,
den Schalttafeln, die schön sind, weil sie
den Stahlstrom beschleunigen,
an den Feldern, die schön sind, weil sie
golden im Einklang tönen,
die ganze spezifische Freude an den
Fenstern, die schön sind, weil sich
der Frieden drin spiegelt;
zu übersetzen, woher die Vergleiche
herholen,
an der ganzen sozialistischen Heimat,
die Freude, die schön ist, weil sie
unser ist.
Über die offensichtlichen Schwächen dieses holprigen Textes muß nicht umständlich gesprochen werden; im Zusammenhang mit Pastiors künstlerischem Weg ist der Text aber trotzdem aufschlußreich: Der Verfasser ist, wie man sieht, auf der Suche nach angemessenen sprachlichen Ausdrucksmitteln für die "ganze spezifische Freude", die er an den Menschen, den technischen Apparaten, der Landschaft, den Häusern und seiner Heimat insgesamt empfindet. Die zur Verfügung stehende Sprache scheint für eine solche Aufgabe aber nicht auszureichen.
Die sozialistischen Parolen und Denk-Vorgaben stehen einer individuellen Kunstäußerung im Wege. Erreicht wird gerade nicht eine neue Sprache für die ganze spezifische Freude, sondern nur ein Rückgriff auf vorgegebene sprachliche und ideologische Muster, auf die "Fertigbauteil- und Ideologiesprache mit verordneten historischen Gesetzmäßigkeiten". Sie vertreten das Allgemeine, die gesellschaftliche Übereinkunft, das überindividuell "Sichere". Von solcher Art Sicherheit muß Abstand genommen werden, wenn wirklich eine "spezifische" persönliche Sprache gefunden werden soll. Das ist der Weg "Vom Sichersten ins Tausendste" (so der Titel des ersten Gedichtbandes nach Pastiors Übersiedlung in den Westen), den dieser Autor mit großer Konsequenz beschritten hat. Er führte ihn aus einer Welt, in der das parteilich Eindeutige zugleich das Sicherste versprach und verbürgte, in die Welt der Vielfalt, der Offenheit, der tausend Möglichkeiten.
Zwischen dem Tausendsten und dem Sichersten, der Freiheit und der Regel spielt sich seither das poetische Werk Oskar Pastiors im ganzen und bis in den einzelnen Vers hinein ab. "Die Zeile als Willkür und Maß" - so hat er die Verfahrensweise seiner Anagrammgedichte kommentiert. Willkür und Maß, Freiheit und Gesetz bestimmen seine Texte gleichermaßen. Der scheinbare Gegensatz zwischen diesen Antipoden ist das ausschlaggebende Movens seiner Poesie. Die Wahl des Gesetzes (etwa einer vorgegebenen Form) ist ein Akt der Freiheit, die Befolgung dieses Gesetzes ist ein Akt der Beschränkung, der freiwilligen, spielerischen Subordination.
Doch verbleiben beide antinomische Pole, sowohl die Willkür als auch das Maß, im rein poetischen Bereich. Sie transportieren keine moralische Maxime, sie verkünden keine Weltanschauung, sie kommen uns schon gar nicht mit einer politischen Botschaft; sie bieten nur das, was sie sind: Kunststücke. Pastior könnte sich auf Goethe berufen, der, als er sich um 1800 in das enge Prokrustesbett des Sonetts bequemte, dieser unbequemen Liegeposition die klassische ästhetisch-moralische Auflösung des Widerspruchs von Gesetz und Freiheit in dem Sonett "Natur und Kunst" abgewann: "In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, / Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben."
Oskar Pastior: "... sage, du habest es rauschen gehört". Werkausgabe Band 1. Herausgegeben von Ernest Wichner. Carl Hanser Verlag, München, Wien 2006. 376 S., geb., 24,90 [Euro].
Oskar Pastior: "Jetzt kann man schreiben was man will". Werkausgabe Band 2. Herausgegeben von Ernest Wichner. Carl Hanser Verlag, München, Wien 2003. 343 S., geb., 19,90 [Euro].
Oskar Pastior: "Minze Minze flaumiran Schpecktrum". Werkausgabe Band 3. Herausgegeben von Ernest Wichner. Carl Hanser Verlag, München, Wien 2004. 348 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Die Rezensentin Gabriele Killert hat ein neues Verfahren entdeckt: die Pastiorisierung. Gemeint sind Oskar Pastiors im wahrsten Sinne des Wortes "unglaubliche" Gesänge. Geradezu betörend findet die Rezensentin die verspielte Sprachmusik, die nach allen möglichen vollendeten Wendungen ihr "Geheimnis" doch nicht "preisgibt". Gedreht und gewendet werden vor allem die heiligen Kühe der Weltliteratur. Zum Beispiel Rilke: "Die Stulle im Palmengarten. Es ist eine himmlische Stulle, die durch die Anlagen geht, von Niemandes Widerspruch bemundet?" Bei Rilke hieß es noch "Stille"! Doch oft gehe es viel weniger offensichtlich zu, etwa wenn Pastior in einem Goethe-Satz alle Worte austausche, und darin nur "die syntaktische Form als Gespenst des Originals" übrigbleibe. Manches könne einem als "höherer Blödsinn" erscheinen, doch verglichen mit dem "Gespreizten" und "Angestrengten", das bisweilen als Lyrik daher komme, habe Pastiors schalkhafter "Nonsens" noch etwas von "ursprünglicher Dichtung". Er vermag es, so die völlig hingerissene Rezensentin, den "bedrängenden Realien" ein "leichteres spezifisches Gewicht" zu geben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die Lektüre ist nach wie vor ein Abenteuer im Dschungel des eigenen Kopfes, weil die Texte den Leser genauso unvermittelt und ungebärdig anspringen wie vor der Jahrzenten ..." Edith Konradt, Siebenbürgische Zeitung, 31.7.03