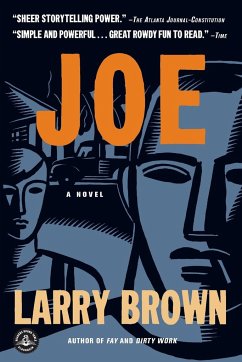Gary Jones schätzt sein eigenes Alter auf etwa fünfzehn. Zusammen mit seinem gewalttätigen Vater, einer apathischen Mutter und seinen beiden Schwestern zieht er obdachlos und ohne Chance auf ein anständiges Leben durch den Süden der USA. Bis er auf den Ex-Häftling Joe Ransom trifft, der sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen versucht. Joe gibt dem eifrigen Jungen einen Aushilfsjob und nimmt ihn unter seine Fittiche. Doch Garys Vater ist damit alles andere als einverstanden. Bald kommt es zur Konfrontation.
Mit einem exklusivem Nachwort von Marcus Müntefering
Mit einem exklusivem Nachwort von Marcus Müntefering