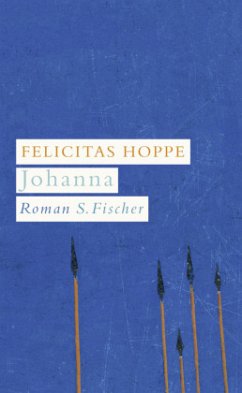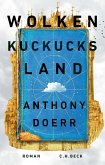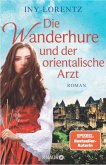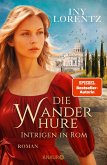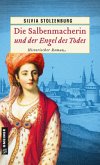Im Jahr 1412 wird im lothringischen Domrémy ein Bauernmädchen geboren. Keine zwanzig Jahre später wird sie als Ketzerin verbrannt. Aber Felicitas Hoppes »Johanna« ist kein Buch über Johanna von Orleans. Dieses Buch ist Johanna selbst, die Geschichte unseres Aufbegehrens und der eigenen unersättlichen Sehnsucht.
Wie geht man mit einer Figur um, die jeder zu kennen glaubt, und über die auch in der Kunst längst alles gesagt scheint? In einer Zeit, in der zwar viel erzählt aber nichts gehört wird, bleibt Johanna eine Provokation. Dies ist ein Buch, das davon handelt, wie man Geschichte macht, wenn man erzählt. Auf den Gang der Geschichte antwortet diese »Johanna« mit der Passion der Literatur, auf die Passion der Johanna mit einem Gespräch über unsere eigene Angst. Felicitas Hoppe verzichtet auf die Rekonstruktion der Biographie. Stattdessen erzählt sie mit historischer Genauigkeit und poetischer Intensität einen Traum von der Wirklichkeit - denn was sind Bücher gegen die Welt?
Wie geht man mit einer Figur um, die jeder zu kennen glaubt, und über die auch in der Kunst längst alles gesagt scheint? In einer Zeit, in der zwar viel erzählt aber nichts gehört wird, bleibt Johanna eine Provokation. Dies ist ein Buch, das davon handelt, wie man Geschichte macht, wenn man erzählt. Auf den Gang der Geschichte antwortet diese »Johanna« mit der Passion der Literatur, auf die Passion der Johanna mit einem Gespräch über unsere eigene Angst. Felicitas Hoppe verzichtet auf die Rekonstruktion der Biographie. Stattdessen erzählt sie mit historischer Genauigkeit und poetischer Intensität einen Traum von der Wirklichkeit - denn was sind Bücher gegen die Welt?

Schnelle Rede, helle Rede, stürmischer Gang: Felicitas Hoppe reist durch die Jahrhunderte bis zum Scheiterhaufen von "Johanna", der Jungfrau von Orléans / Von Tilmann Lahme
Alles beginnt ja, wie immer, im Kopf, und im Kopf ist es dunkel, vielleicht sogar finster, bis endlich einer kommt, der den passenden Lichtschalter findet. Und irgendeiner kommt immer vorbei."
Felicitas Hoppe, die den Lichtschalter zur Jungfrau von Orléans in ihrem neuen Roman "Johanna" sucht, ist nicht die erste, wahrlich nicht. Schwer ist es, nahezu unmöglich, nach Jahrhunderten durch den mythischen Nebel zu jener Frau durchzudringen, die während des Hundertjährigen Krieges zwischen Engländern und Franzosen, getrieben von Offenbarungen, sich mit Schwert und Gebet an die Spitze des französischen Befreiungskampfes setzte, bis sie schließlich nach einem Inquisitionsprozeß zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wird.
Die Geschichte von Jeanne d'Arc ist ein nationaler Mythos der Franzosen. Nationalisten und Klerikale, Konservative und Revolutionäre, Faschisten und Demokraten beriefen sich auf die Jungfrau, stellten wahlweise das Egalisierende ihres Wirkens, ihre Verteidigung der gottgewollten Ordnung, ihre göttliche Mission oder ihren Kampf für die Nation in den Vordergrund. Im von Hitler-Deutschland besetzten Frankreich etwa beriefen sich sowohl die Kollaborateure in Vichy auf Jeanne d'Arc als Verkörperung von Gehorsam und Tradition als auch die Résistance, die Johanna als Befreierin Frankreichs von illegitimer und fremder Herrschaft anriefen. Selbst den heutigen Rechtspopulisten um Le Pen in Frankreich entgeht Jeanne d'Arc nicht und muß als Symbolfigur für den Kampf gegen Überfremdung herhalten.
"Erkenne die Jungfrau". Felicitas Hoppes selbsterhobener Anspruch ist hoch, zumal sich zum jahrhundertelangen Kampf um die politische Johanna noch der verwandte um die literarische gesellt. Voltaire griff in seinem Johanna-Stück "La Pucelle d'Orléans" die Kirche und das finstere Mittelalter an. Schiller konzipierte seine "Jungfrau von Orleons" als Antwort auf die Voltaireschen Gemeinheiten. Bernard Shaw wiederum warf Schiller vor, die Jungfrau in einem "Hexenkessel tobender Romantik" ertränkt zu haben. Ihm galt sie als "erste Protestantin". Bertolt Brecht hingegen schickte sie gleich mehrfach in den Klassenkampf seiner sozialkritischen Parabeln.
All das interessiert Felicitas Hoppe überhaupt nicht. Nicht die politische Instrumentalisierung, nicht die Suche nach der historischen Figur. Johanna als erster Apostel des Nationalismus? Alles Theater. "Englisch, französisch, das spielt keine Rolle. Johanna war schließlich die Tochter Gottes. Und hätte Gott sie englisch besetzt, dann hätte sie für England gekämpft."
Eine namenlose Ich-Erzählerin beschäftigt sich seit Jahren mit der Jungfrau von Orléans. Ein intelligenter junger Wissenschaftler ist ihr Gefährte. Beide sind sie "falsche Priester kurz vor der Weihe, aber jeder eine Schwelle für sich, über die keiner kommt". Auch die Schwelle der erotischen Annäherung werden sie nicht überschreiten, trotz gegenseitiger Neigung. Es bleibt jungfräulich unschuldig, bis zum Schluß: "Und morgen, falls es das Wetter erlaubt, werden wir uns duzen." Die Hürde der Promotion hat der Kompagnon bereits genommen, für die Ich-Erzählerin steht sie noch aus. Aber es regiert der Zweifel. Kann man mit Fakten und historischer Forschung, "verschrobener Knappenprosa" also, einem Phänomen wie der Jungfrau überhaupt nahekommen? "Nur Johann ist nicht darauf angewiesen, denn wie wir die Fakten auch drehen und wenden, wir sind fast tot, und sie bleibt lebendig." Eine kuriose Relativitätstheorie.
"Schnelle Rede, helle Rede, stürmischer Gang", tritt Johanna in die Szene. "Nicht groß, nicht klein, nicht lang, sondern kurz, nicht blond, sondern braun, nicht höflich, sondern eckig und schnell. Nicht schön, sondern ländlich." Eben nicht Ingrid Bergman, die gleich zweimal die Jungfrau im Film gab: schön, pathetisch und überrüstet. Aber auch die "reale" Johanna ist nicht, was Felicitas Hoppe sucht. Ganz im Gegenteil: Jener Historiker, der als Krönungsexperte Fachmann sein soll für etwas, das doch nur die Jungfrau konnte, einem legitimen Herrscher zur Krönung verhelfen, ist der Widerpart der Johanna-Suchenden. Ein Wissenschaftler, der von Fußball schwärmt, Emotionen aber als irrelevant aus der Geschichte verbannt. Weibliches Gedöns. Ein leitmotivischer Rauchdunst geht von dem Professor aus. Die Flammen bedrohen alle, die sich mit der auf dem Scheiterhaufen verbrannten Jungfrau einlassen - es sei denn, sie wahren Distanz wie der Wissenschaftler, der, nur nach Rauch stinkend, der lodernden Helligkeit der Erkenntnis nicht nahe genug kommt. Aber auch das weibliche Ich hat Angst vor dem Feuer, mag nicht ihre Hand danach ausstrecken: "Ich fürchte den Wind und um meine Finger."
Angst hemmt, mehr noch treibt sie aber an. So auch in der Promotionsprüfung, eine leuchtende, dichte, grandiose Szene des Romans, der man auch die etwas überdehnte Analogie zu den Inquisitionsverhören Johannas verzeiht. Die Ich-Erzählerin steht vor der Tür des Professors, von der sie weiß, daß sie den Kopf senken, sich also künstlich klein machen muß, von der Literatin zur Historikerin, um im akademischen Sinn erfolgreich zu sein. "Die Tür und die Stille. Der eigene Atem. Der Blick auf die Uhr. Die schweißnassen Hände. Die Angst vor dem Klopfen. Finger aus Blei. Womöglich fallen die Finger ab, bevor sie die Klinke erreichen. Plötzlich von drinnen leises Gelächter. Das Rücken von Stühlen. Dann wieder Gelächter. Ich drehe mich um. Kein Zweifel möglich, man lacht über mich. Ist ja sonst keiner da." Die Paranoia des Prüflings, die Angst vor dem Kommenden. "Nicht die Prüfung ist schrecklich, schrecklich ist nur die Prüfung davor. Die Nacht davor und der Morgen davor." Daß die Promotionsprüfung scheitert, ist unwichtig, wird nur nebenher deutlich. Wichtig ist die endgültige Erweckung der Geprüften zur Literatin, dank Johanna.
Es ist phantastisch, beziehungsreich, verästelt, oft gebrochen und vieldeutig, niemals eindimensional, aber immer sprachlich brillant, wie Felicitas Hoppe auf die Suche nach ihrer Johanna geht. Die große Sprachreisende nimmt den Leser mit auf eine Romanfahrt, um an der ersten Gabelung mit einer eleganten Drehung im Unterholz zu verschwinden. Soll der Leser doch selbst durch das Dickicht aus Assoziationen, Sprachspielen, Verfremdungen, Zitatkollagen und Andeutungen finden. Für eine Weile zumindest, dann kehrt sie zurück. Lockt weiter in ihre Hoppe-Welt mit ihren eigenen Regeln und Rätseln. Das ist auch anstrengend, ermüdend, gelegentlich von marternder Übersättigung, wenn der Leser, von assoziativen Bocksprüngen und rätselhaften Wendungen überlastet, den Boden endgültig unter den Füßen verloren zu haben glaubt. Wer eine erzählte Geschichte, Handlung schätzt, sollte die Finger von diesem Buch lassen, mehr noch als von allen vorhergehenden Felicitas Hoppes. Ohne vertiefte Johanna-Kentnisse bleibt zudem vieles unklar, zumal zahlreiche Gegner und Mitstreiter auftreten. Zum Hoppe-Verständnis taugt "Knappenprosa" also doch.
Was aber, fragt man sich, fasziniert Felicitas Hoppe so sehr an Johanna? Eine neue Deutung bietet sie nicht an. Es scheint, als seien ihre Motive gleichsam klassisch, umgesetzt in einem modernen Sprachkunstwerk. Die unschuldige Heilige mit dem blutigen Schwert, eine "Tochter Gottes", wie es mehrfach heißt. Auch die Wendungen und Brüche ("Johanna, mein Prahlhans, Aufschneider Gottes!") führen von dieser religiösen Linie nicht weg, die man aus früheren Texten Hoppes, vor allem aus "Paradiese, Übersee", bereits ahnte. Ein intimes Thema, weshalb Felicitas Hoppe wohl den Leser nicht ständig an ihrer Seite wissen wollte.
Felicitas Hoppe: "Johanna". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006. 173 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Die Rezensentin Wiebke Porombka zeigt an drei historischen Romanen (Bernd Schroeders "Hau", Felicitas Hoppes "Johanna" und T. Coopers "Lipshitz"), was der historische Roman der Gegenwartsliteratur beizubringen hat: die Reflexion über das Verhältnis von Fakt und Fiktion und den Willen zur bedingungslosen, poetischen Aneignung des Geschehenen. Auf Hoppe trifft dies für die Rezensentin uneingeschränkt zu. In ihrer Geschichte um die als Ich-Erzählerin auftretende Geschichtsstudentin, die im Rahmen ihrer Promotion die Figur der Johanna von Orleans erforscht, setze sie gekonnt den leidenschaftlichen und zermürbenden Prozess der Aneignung und Fortschreibung historischen Stoffes in Szene. Die Erzählerin komme in akademischer Hinsicht zu Fall, als sie sich weigert, die Geschichten der Geschichte lediglich "nachzubeten", sondern sich ihnen in poetischer, empathisch aneignender Weise nähert. Mit diesem vor "Sprachlust" sprühenden Roman, so das lobende Fazit der Rezensentin, stellt Hoppe einen Poesiebegriff in den Raum, der die "dichterische Aneignungsenergie und Gestaltungskraft" in den Vordergrund stellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH