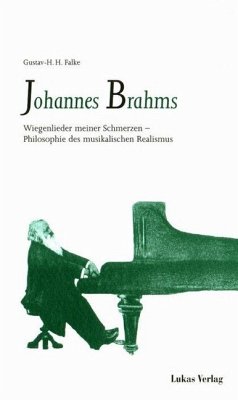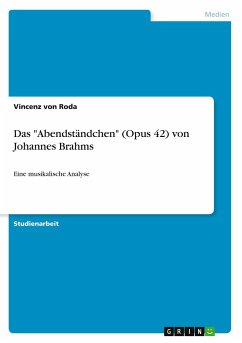Brahms ist Zeitgenosse der Realisten. Aber kann es realistische Musik geben? Die Frage muß unbeantwortbar bleiben, wenn Realismus nur über die Abbildung von Realität definiert wird. Tatsächlich wollen Fontane, Raabe oder Keller den Gegensatz zwischen der "Poesie des Herzens und der Prosa der Verhältnisse" (Hegel) in unparteilicher Objektivität gestalten. Ihr Realismus ist also eine Kunst des Vermittelns. Das aber ist gleichermaßen Brahms Kompositionsweise. Johannes Brahms als Realist - das ist keine Etikettenspielerei.

So eigenwillig Gustav Falke auch aufspielt, die Brahms-Forschung läßt sich nicht einschüchtern
Dieses Buch läßt sich nicht leicht lesen. Sind die Sätze zu gewunden? Ist die Wortwahl zu gesucht? Nichts von alledem. Gustav-H. H. Falke schrieb diesen polemisch gedachten Brahms-Essay so, wie man es von seinen Rezensionen und Musikkritiken her gewohnt ist: mit einer flüssigen Feuilletonfeder. Seite für Seite rutschen die Formulierungen wie von selbst am Leser vorbei. Kaum wird man gewahr, daß man überhaupt liest, hat - gerade ist eine Seite umgewendet - schon wieder vergessen, was man las, muß zurückblättern und kommt nicht recht von der Stelle. "Dann lesen Sie mein Buch doch mal von hinten", empfiehlt lächelnd der Autor, als man ihm nach Monaten zufällig begegnet und die liebe Not klagt.
Im letzten, sechsten Kapitel des Buches schreibt Falke über die "Logik der kompositorischen Entwicklung". Das beginnt mit der spannenden Frage, wie und wodurch der Stilwandel in der Musik um 1900 bewirkt worden sei, weg von der üppigen wuchernden Spätromantik hin zur kargen Zwölftonmusik. Diese Frage bleibt zwar offen, aber das ist nicht wichtig, immerhin hängen an ihr allerhand Folgefragen, darunter die nach dem Wesen der Musik. Ist die Musik eine tönend bewegte Form? Oder hat die Form einen Inhalt und die Musik etwas Bestimmtes zu sagen? Und so weiter. Zweifellos eine der größten und prinzipiell unbeantwortbaren Fragen der abendländischen Musikgeschichte. Doch gemach, zunächst zurückgeblättert.
Den Stilwandel von Brahms zu Schönberg beschreibt Falke als eine Geschichte des Niedergangs: In der Musik, parallel dazu in Literatur und bildender Kunst, verschwinde mit "Tonalität" und "Perspektive" auch die "Einheit der Handlung". Weiter heißt es, erläuternd, kategorisch und überraschend: "Die Tonalität ordnet das Ausgedrückte in der Zeit." Ausgedrücktes? Ist es nicht zunächst der Klang, Einzeltöne und Akkorde, die musikalisch in eine zeitliche Abfolge nach- und eine möglichst sinnvolle Beziehung zueinander gebracht werden? Daß der Musik eine über das schiere Schallereignis hinausweisende Bedeutung eignet, diese Hoffnung ist zwar nicht neu. Spätestens seit Josquin Desprez trat die Musik des Abendlands mit dem Anspruch auf, etwas auszudrücken: Sie wurde Klangrede. Und seither haben die Musiker und Musikphilosophen immer neue Anstrengungen unternommen, das flüchtige Ding festzuhalten und seinen Sprachcharakter zu definieren, von der musica poetica bis zum Leitmotiv, von der Idée fixe bis zum Lied ohne Worte, über Textierung, Tropierung, Zitat, Devise, Chiffre, Tonmalerei und die musikalische Rhetorik.
Dabei ging es nie einfach nur um Musik als Ersatzsprache, sondern um die Eigenständigkeit und Sprachähnlichkeit von Musik. Die Musik sei Sprache des Unaussprechlichen, meinte E. T. A. Hoffmann. "Allein, man muß doch hiebey wissen, daß auch ohne Worte, in der blossen Instrumental-Music allemahl und bey einer ieden Melodie, die Absicht auf eine Vorstellung der regierenden Gemüths-Neigung gerichtet seyn müsse, so dass die Instrumente, mittelst des Klanges, gleichsam einen redenden und verständlichen Vortrag machen", heißt es dazu in den Regeln zur musikalischen Rhetorik des Johann Mattheson anno 1739. Nun kommt freilich Mattheson bei Falke nicht vor, auch die einschlägige Musiktheorie des achtzehnten und des neunzehnten Jahrhunderts nicht. Er macht sich seine eigenen Gedanken.
Da findet man, zurückblätternd ins dritte Kapitel, welches ausdrücklich vom Ausdruck handelt, etwas über Desprez und einige kryptische Definitionen. Zum Beispiel: Das "Ausdruckshafte" in der Musik entspricht dem "Abbildhaften" in Literatur und bildender Kunst. Oder: "Jede Musik hat einen Ausdruck", doch der "Ausdruck ist nicht ihre primäre Bestimmung" (beispielsweise bei Desprez; dessen Motetten primär der Ehre Gottes bestimmt sind). Schließlich: Dem "Ausdruck" ist einerseits die "Darstellung" und andererseits die "Bedeutsamkeit" entgegengesetzt, und zwar als "Sinnarten". Das klingt wie ein kompliziert verschraubtes Mißverständnis.
Die Schwierigkeit für den Leser, nichts miß- und den Text richtig zu verstehen, liegen vor allem darin, daß der Autor sich seine analytischen Begriffe selbst neu und umdefiniert, wobei mit einer gewissen ahistorischen Beliebigkeit vor allem die fixierte Terminologie laufend über den Haufen geworfen wird. Er schreibt etwa über den "Charakter" oder die "Einheit des Affekts", ohne den Kontext der Konventionen zu streifen, die diesen Begriffen in der Musiktheorie des achtzehnten oder der Musikästhetik des frühen neunzehnten Jahrhunderts zugewachsen sind. Verwirrt blättert man zurück ins erste Kapitel.
Und hier, endlich, begreift man des Autors hochgesteckte Absicht. Er will "Form als Gehalt denken" und mit diesem Essay endlich den fälligen Beweis führen, daß die Instrumentalmusik von Johannes Brahms realistisch ist, so wie auch die Romane Fontanes realistisch sind, was in eine kleine Philosophie des musikalischen Realismus münden soll. In der Brahmsforschung rennt Falke damit freilich sperrangelweit offene Türen ein. Er selber stellt allerdings nach Sichtung der Literatur fest, daß die Musikwissenschaft "nur rudimentär über eine Theorie der musikalischen Bedeutung verfügt". Das ist verwunderlich. Denn seit jeher befaßten sich die Musikdenker, wie gesagt, mit nichts anderem. Liest man vom Ausgedrückten, welches Falke fallweise in der Più-Adagio-Passage des langsamen Satzes des zweiten Klavierkonzerts von Brahms findet ("das Rauschen der eisigen Woge der Ewigkeit"), dann sind die geheimen poetischen Programme, die Arnold Schering vor rund hundert Jahren in Beethovens Symphonien entdeckte, nicht weit weg.
Neuere Brahmsbücher, die im Werk die Spuren des wirklichen Lebens verfolgen, etwa die Brahms-Biographie von Constantin Floros oder aber den von Hanns-Werner Heister voriges Jahr edierten Sammelband über "Brahms und die Relativierung der absoluten Musik", waren dem Autor bei Abfassung seines Essays offenbar noch nicht bekannt. Er hätte sich seine Polemik sparen können. So aber kämpft er vergeblich gegen Geister, die er sich selber schuf und nicht mehr los wird. ELEONORE BÜNING.
Gustav-H. H. Falke: "Johannes Brahms". Wiegenlieder meiner Schmerzen - Phi losophie des musikalischen Realismus. Lukas Verlag, Berlin 1997. 179 S., Abb., br., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Was Falke an Parallelen, Entsprechungen zwischen Literatur, Zeitgeist und Brahms' Musik aufspürt, zeugt von bedeutender ästhetischer Empfindlichkeit ... Falkes interdisziplinäres Verfahren ist an sich nicht neu, wird aber von ihm mit einer Genauigkeit gehandhabt, die durchaus einen qualitativen Sprung bezeichnet ... Die Bedeutung seines Buches liegt darin, dem Sprechen über Musik einen neuen Weg gewiesen, dem Denken über ihre Inhalte neue Möglichkeiten aufgezeigt zu haben." (Peter Uehling in der Berliner Zeitung)