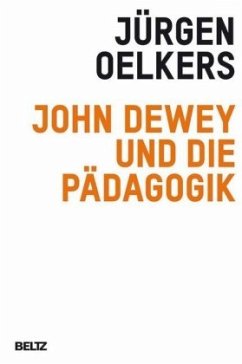John Dewey gehört neben Jean Piaget zu den weltweit bekanntesten Vertretern der Pädagogik. Jürgen Oelkers, einer der versiertesten Kenner Deweys, legt ein Buch über Deweys Leben und Werk vor, das gleichzeitig die spannende Bildungsgeschichte der USA erzählt.
Oelkers zeigt uns Dewey in allen seinen Facetten und lässt ein lebendiges Bild entstehen, wie der Philosoph zu einem der größten Reformpädagogen unserer Zeit wurde. Wie sich Demokratie als Lebensform und Erziehung in Einklang bringen lassen, diese fortwährend aktuelle Frage stand für Dewey im Zentrum. So war er ein politischer Intellektueller, der in vielen Kontroversen Stellung bezog und als Leiter der "Laborschule" in Chicago, als Berater internationaler Regierungen oder auch durch die Verteidigung Leo Trotzkis gegen die Urteile in den Moskauer Schauprozessen Geschichte machte.
Oelkers zeigt uns Dewey in allen seinen Facetten und lässt ein lebendiges Bild entstehen, wie der Philosoph zu einem der größten Reformpädagogen unserer Zeit wurde. Wie sich Demokratie als Lebensform und Erziehung in Einklang bringen lassen, diese fortwährend aktuelle Frage stand für Dewey im Zentrum. So war er ein politischer Intellektueller, der in vielen Kontroversen Stellung bezog und als Leiter der "Laborschule" in Chicago, als Berater internationaler Regierungen oder auch durch die Verteidigung Leo Trotzkis gegen die Urteile in den Moskauer Schauprozessen Geschichte machte.

Jürgen Oelkers zeigt, dass man von John Dewey für aktuelle Debatten um Schule und Erziehung vieles lernen kann.
Von Jürgen Kaube
Der Satz, wir lernten nicht für die Schule, sondern für das Leben, ist die Umkehrung eines Seneca-Wortes, das aber genauso schulkritisch gemeint war. Er hat zwei Schwächen. Zum einen gehört die Schule selbst zum Leben, und jeder, der eine besucht hat, also wirklich jeder, weiß, wie sehr. Zum anderen ist "Leben" ein recht vieldeutiger Ausdruck.
Heute machen sich die meisten Eltern - und auch alle Ungleichheitsforscher - Sorgen, ob die Schule ausreichend fürs Berufsleben vorbereitet, für erfolgreiche Karrieren und Aufstieg also. Doch selbstverständlich wartet das Leben noch mit anderen Aufgaben und Zumutungen auf als der, Wohlstand zu erlangen. Da sind Lieben und Ehen, politische Wahlen, Nachbarschaften, die man pflegen oder verderben kann, die Gesundheit und der Glaube, also die Frage, ob man verzweifelt sein muss, handwerkliche Probleme, solche der Kindererziehung und viele mehr.
Der Held dieses Buches, der amerikanische Philosoph John Dewey, hat von der Schulerziehung gefordert, sie müsse in erster Linie auf die Demokratie vorbereiten. Das wäre missverstanden, würde man meinen, Dewey habe sich einen Lehrplan vorgestellt, der nur ein Fach kennt, nämlich Staatsbürgerkunde. Demokratie hieß für ihn: die Gesellschaft. Eine, in der man mit Umschwüngen und mit Mobilität rechnen muss. Eine, in der alles, was gilt, auch in Frage gestellt werden kann. Eine, die dem Wissen und der Auswertung von Erfahrungen einen hohen Rang einräumt. Erziehung zur Demokratie hieß für Dewey darum Erziehung zum problemorientierten Denken.
Der in Zürich lehrende Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers erläutert diesen Gedanken auf äußerst lesenswerte Weise. Zunächst schildert er, welche Widerstände in den deutschen pädagogischen Milieus mit deren Tradition eines aufgequollenen Idealismus den Anregungen Deweys entgegenstanden. Man beschwerte sich, Dewey rede einer "Anpassung an das soziale Leben" das Wort. Er kenne nur die Gegenwart, nicht die Vergangenheit als Maßgabe des Unterrichts, nur die Rolle in der Gemeinschaft, nicht die Seele des Einzelnen. Im Grunde lautete der Vorwurf, dass Dewey den Primat der Geisteswissenschaften in der Erziehung nicht anerkenne. Oelkers entziffert den Schichtungsindex dieser Beschwerde: Es waren die Reserven einer Pädagogik, die für Bildung ohnehin nur wenige Mitglieder einer Gesellschaft vorsah und den Rest auf Gottesglauben und Autorität verwies.
Die amerikanische Schule, deren Geschichte Oelkers umreißt, hatte sich im 19. Jahrhundert vielerorts aus religiösen Vorgaben befreit. Vor allem das Städtewachstum, der "Migrationshintergrund" der Bevölkerung und der Aufstieg der experimentellen Naturwissenschaften regten die Suche nach neuen Lehrplänen an. Dewey wandte sich gegen "literarische Gedächtnisspiele" und "Herrscherlisten" als Unterrichtsstoffe, aber auch gegen das bloße naturkundliche Wissen. Individualität verlange auch nicht die Kultivierung einer inneren Gegenwelt zur äußeren Gesellschaft, sondern die Fähigkeit, mit gegebenen Umständen zurechtzukommen, Neues verarbeiten zu können und Fremdes zu verstehen. Demokratie scheitert, wenn Ignoranz vorherrscht, Freiheitsgebrauch verlangt Intelligenz.
Erziehung ist darum weder Entfaltung von Anlagen noch Training oder Wertevermittlung, sondern Denkschulung an Stoffen. Oelkers arbeitet diese Besonderheit ideengeschichtlich sehr sorgfältig heraus, mit vielen informativen Kapiteln zu Zeitgenossen Deweys, zu Kontroversen über seine Pädagogik - vor allem die mit Verfechtern elitärerer Bildungsbegriffe wie Walter Lippmann und Robert M. Hutchins - und zu Deweys Laborschule in Chicago.
Dabei schont er den Klassiker nicht, unterstreicht vielmehr Deweys fehlenden Sinn dafür, dass nicht alle Stoffe gleichermaßen gut geeignet sind, zum Denken, Experimentieren und Problemlösen anzuregen. Und dass der Lehrer unterrichten soll, die Schüler sich nicht selbst unterrichten können. Mitunter fehlt dem Buch die Bereitschaft, in solchen Fragen zu klaren Schlussfolgerungen zu kommen. Aber für eine Gegenwart, die ja immer noch gern den Unterricht auf utopische Ziele bezieht, von Kindern anstatt von Schülern redet, von Individuen anstatt von Schulklassen, die unterrichtet werden, von "Leitkultur" oder "Emanzipation" anstatt von Denkfähigkeit und Können als Unterrichtszwecken, ist Oelkers klar genug.
Dewey konnte zu seinen Überlegungen kommen, weil er nicht allein war. Das Buch zeigt sehr gut, wie etwa Gedanken des Sozialpsychologen George Herbert Mead zur Rolle des Spiels in der kindlichen Entwicklung, der Übergang von "play" zu "game", also von freiem zu regelhaftem, auf andere und die Erwartungen anderer bezogenem Spielen ein Modell für Erziehung überhaupt ist. Andere Einflüsse kommen von Charles Sanders Peirce, der unter anderem auf die Bedeutung der Fähigkeit hingewiesen hatte, mit Überraschungen etwas anzufangen. Daraus entstehen bei Dewey und seinen pädagogischen Mitstreitern an der Elementarschule der Universität von Chicago Unterrichtsideen: Naturkunde ohne Bücher beispielsweise oder Projektunterricht.
Das Buch von Jürgen Oelkers zeigt, dass man sich die besten Antworten auf die Frage, was einen guten Unterricht auszeichnet, nicht alle selbst ausdenken muss. Das heißt auch, dass wir in den Erziehungsdebatten seit einhundert Jahren im Grundsätzlichen nicht weit vorangekommen sind. Die Schule muss nicht neu erfunden werden. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Nachricht, denn es impliziert ja auch, dass die vergangenen Anstrengungen nicht vergebens waren und nicht nur von historischer Bedeutung sind. Man lernt ungeheuer viel durch die Lektüre. Fürs Leben und für die Schule.
Jürgen Oelkers: "John Dewey und die Pädagogik". Beltz Verlag, Weinheim 2009. 347 S., geb., 32,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Man lernt ungeheuer viel durch die Lektüre. Fürs Leben und für die Schule." -- FAZ
"Oelkers zeigt uns Dewey in allen seinen Facetten und lässt ein lebendiges Bild entstehen, wie der Philosoph zu einem der größten Reformpädagogen unserer Zeit wurde." -- Pädagogische Rundschau
"Oelkers zeigt uns Dewey in allen seinen Facetten und lässt ein lebendiges Bild entstehen, wie der Philosoph zu einem der größten Reformpädagogen unserer Zeit wurde." -- Pädagogische Rundschau
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit großem Gewinn, versichert Rezensent Jürgen Kaube, hat er diese Darstellung der pädagogischen Ideen des Philosophen John Dewey gelesen. Sichtbar werde Deweys Denken darin nämlich als veritables Gegengift zum deutschen Idealismus mit seinen Innerlichkeitsvorstellungen. Nicht Seelenbildung ist für Dewey das Ziel, sondern Vorbereitung des Menschen auf die Demokratie. Das heißt aber alles andere als immerwährender Sozialkundeunterricht. Vielmehr werde die und der Lernende zum Demokraten für Dewey durch "Denkschulung an Stoffen". Durch prinzipielle Fähigkeit zum Infragestellen und zum "problemorientierten Denken". Der Autor Jürgen Oelkers zeige, so Kaube, zwar den einen oder anderen blinden Fleck bei Dewey auf, stelle den Deweyschen Ansatz aber grundsätzlich zustimmend dar. Und dagegen hat der Rezensent rein gar nichts einzuwenden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH