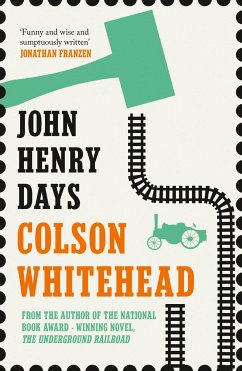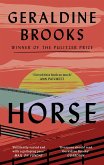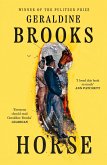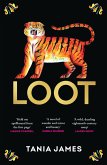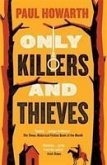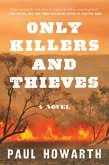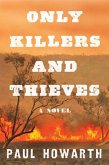Through a patchwork of interweaving histories, Colson Whitehead reveals how America creates its present through the stories it tells of its past.
From the author of â The Underground Railroadâ , Winner of the Pulitzer Prize and the National Book Award, and Longlisted for the 2017 Man Booker Prize. â John Henry Daysâ is a novel of extraordinary scope and mythic power. It established Colson Whitehead as a pre-eminent American writer of our time.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
From the author of â The Underground Railroadâ , Winner of the Pulitzer Prize and the National Book Award, and Longlisted for the 2017 Man Booker Prize. â John Henry Daysâ is a novel of extraordinary scope and mythic power. It established Colson Whitehead as a pre-eminent American writer of our time.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Colson Whitehead erzählt in "John Henry Days" alte Heldengeschichten in neuer Zeit
"Ist nicht so der allerszenigste Ort Berlins, an den Sie mich hier für dieses Interview gebracht haben?" fragt Colson Whitehead zweifelnd und steckt sich eine Zigarette an. An der Wand des großen holzgetäfelten Saales hängen ein Hirsch und Jagdszenen in Öl, an der Decke tropfenförmige Lampen im Milchglasschein, und an den Nebentischen stopfen kleine ältere Damen mit hochgesprühtem weißen Haar große Mengen Torte in sich hinein. Vor dem Fenster stapfen Enten durch den Matsch, und der Wannsee liegt braun und leer herum. Nein, ist es nicht, zugegeben. Die Moorlake, schwarzwaldartiger Erholungsort, den der Schinkel-Schüler Persius einst erbaut hatte, ist eher ein Berliner Rentner-Traumort. "Im Sommer ist es hier wahrscheinlich ganz schön", sagt Whitehead rauchausatmend. Das soll wohl höflich klingen.
Der vierunddreißig Jahre alte New Yorker Schriftsteller Colson Whitehead ist zum ersten Mal in Deutschland. Als sein erstes Buch, "Die Fahrstuhlinspektorin" vor vier Jahren auf deutsch erschien, war er nicht gekommen. Das Buch, das in Amerika von "Esquire" zum Roman des Jahres und von "GQ" gar zu einem der besten Bücher des Millenniums gewählt worden war, hatte in Deutschland überhaupt keinen Erfolg. Wie viele hier verkauft wurden? "Zwei Exemplare", sagt Whitehead lachend, und er wundert sich nicht, daß sein alter Verlag noch vier Jahre später großzügig Gratisexemplare an Journalisten verschickt. "Die müssen noch Tausende von dem Ding haben."
Sein neues Buch "John Henry Days", das in den Vereinigten Staaten ein noch größerer Erfolg war und von Jonathan Franzen und John Updike ausführlich gerühmt, von den Lesern gefeiert wurde, soll ihm endlich auch in Deutschland den Durchbruch bringen. Sein neuer Verleger, Michael Krüger vom Hanser-Verlag, tut jedenfalls alles dafür, verschickte frühzeitig einen enthusiastischen Whitehead-Begeisterungsbrief an die Literaturredaktionen des Landes, damit diese den Roman nicht wieder zwischen all den anderen amerikanischen Neuerscheinungen übersehen, und holte den Schriftsteller rechtzeitig, mit Unterstützung der Berliner American Academy, zur Buchvorstellung nach Deutschland.
Jetzt ist er da, sitzt in dem dunklen, alten Jagderholungsraum am Berliner Stadtrand bei Rumpsteak und Bier und redet über New York, Berlin, das Rauchen und sein Buch. "John Henry Days" ist die Geschichte einer Schar von abgehalfterten Journalisten, die sich eines Tages bei einer Pressereise in Talcott, West Virginia, treffen, um der Präsentation einer John-Henry-Briefmarke beizuwohnen und dem erstmals veranstalteten Helden-Volksfest namens John-Henry-Days. Und es ist auch die Geschichte eines Mythos. Eines amerikanischen Heldenmythos, den dortzulande jedes Kind kennt. Die Geschichte von John Henry, dem schwarzen Bohrhauer, der bei einer riskanten Tunnelbohrung in der Nähe von Talcott vor mehr als hundertdreißig Jahren sein Leben verlor. Er starb im Kampf gegen eine Maschine, von der behauptet wurde, sie könne die Arbeit der menschlichen Bohrhauer in Zukunft übernehmen. Schneller und besser, sauberer und billiger. "Es war der törichte Traum eines verrückten Wissenschaftlers, und dennoch erstarrten die Eisenbahnarbeiter vor Ehrfurcht. Vor Angst. Außer unserem John Henry, der in diesem komischen, komplizierten Gefüge die nahtlose Konstruktion seines Schicksals erkannte", heißt es in Whiteheads Roman. "John Henry spuckte in die Hände und sagte, er könne es mit jeder von Menschenhand stammenden Maschine aufnehmen und jederzeit schneller bohren als dieser Haufen Schrott. (Hybris, die Sünde der Griechen, jedenfalls eine davon.) Er lasse sich nicht von irgendeiner Großstadtteufelei verdrängen." John Henry kämpfte. Und er gewann sogar gegen die Maschine, wie es im Mythos heißt. Und wenig später war er tot. Hirnschlag. Herzschlag. Ende eines schwarzen Helden.
Doch die Geschichte des Mythos fängt hier erst an. Colson Whitehead wandert erzählerisch mit dieser Heldensage durch das Jahrhundert, findet hier Parallelen auf einem Rolling-Stones-Konzert, dort mögliche John-Henry-Wiedergänger in einer Südstaatenfamilie, zitiert John-Henry-Songs, beschreibt John-Henry-Comics, John-Henry-Filme und kehrt immer wieder in die Gegenwart zurück. Zur Präsentation jenes kleinen postalischen Heldenbildchens in Talcott, West Virginia, und zur Gruppe der reisenden Schnäppchenjournalisten, die außer Gratisreisen, Gratisspeisen und den wohlfeilen Preisen jeder noch so nutzlosen PR-Veranstaltung wenig im Kopf zu haben scheinen. Allen voran der König der Spesenritter, der schwarze Journalist J. Sutter aus New York, "ein dem Trägheitsmoment gehorchender Lohnschreiber, der Quittungen hamstert, denn er ist auf einer dreimonatigen Spesentour, die zu unterbrechen ihm die Bereitschaft und der Mut fehlt." Sutter steht kurz vor einem Rekord. Einem Langzeitrekord des Gratislebens auf Pressereisen. Da läßt man sich besser nicht so einfach rausbringen.
Jedoch: Das Festival, die Briefmarke, die Zeit, der immer noch grassierende Rassismus im West Virginia der Gegenwart, der Mythos, die Liebe und der Roman verändern etwas im Leben des J. Sutter. Er nähert sich dem Helden an, den er eigentlich als kleine Briefmarke in einem schnellen Hundertzeiler von sich wegschreiben wollte.
John Updike hatte in seiner lobenden Kritik im "New Yorker" bei Erscheinen des Buches in Amerika geschrieben, der schwarze Billigjournalist J. Sutter habe leider bei weitem nicht das Zeug zu einem neuen John Henry. Und außerdem erscheine ihm die schwarze Hautfarbe des neuen und des alten Helden etwas überbetont. Die Hautfarbe sei doch letztlich gleichgültig. "Schön, daß er gut über mich schreibt", sagt der Harvard-Absolvent Colson Whitehead und schüttelt die kurzen Rasta-Locken. "Aber leider hat Updike den Roman nicht verstanden. Vielleicht auch nicht wirklich gelesen. Ihn interessiert es nicht wirklich, daß irgendwo ganz da unten junge schwarze Bürschchen auch Bücher schreiben. Rassismus ist natürlich ein wichtiges Thema des Buches."
Das in der Tat geradezu leitmotivisch den Roman durchzieht. Als ständige Bedrohung, Angst und Schrecken: "Ein Schwarzer hat hier nichts verloren", heißt es über Talcott. "Hier ist einfach zuviel Übles, zuviel Geschichte gelaufen. Genau das wollen sie. Sie wollen uns tot sehen."
Doch Rassismus ist keine Frage der Provinz. Whitehead erzählt von seiner Nachbarschaft in Brooklyn, wo er lebt, die fast ausschließlich schwarz ist, und den Polizeibeamten am Ort, die fast ausnahmslos weiß sind. "Einfach damit du jeden Moment siehst, auf welcher Seite die Macht, die Staatsgewalt steht." Und von dem Aufräumer Giuliani erzählt er, dem Saubermann, den nach dem 11. September plötzlich alle liebten, und Michael Bloomberg, dem Mann, den auch wieder fast alle lieben, weil er so kompromißlos gegen die Raucher vorgeht. Whitehead bläst Rauch aus, lächelt und sagt, er sei auch sehr dafür, für das strenge Rauchverbot in Kneipen und Restaurants. Es schweiße die Raucher so zusammen. Zu einer Kältenotgemeinschaft, jetzt, im kalten Winter in New York. Gut, zugegeben, mitunter sei es natürlich doch sehr schön, mal wieder im Warmen zu Rauchen. Wie hier, auf den grünen Cordstühlchen unter dem Hirschgeweih.
Wenigstens ein kleiner Vorteil des unszenigen Tortenparadieses, hier, am Rande von Berlin.
VOLKER WEIDERMANN
Colson Whitehead: "John Henry Days". Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Carl Hanser Verlag, München. 526 Seiten. 24,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main