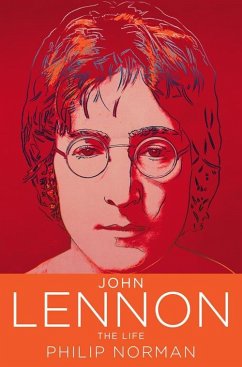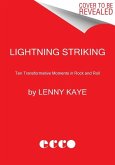The final word on musicâ s greatest legend, in which Philip Norman reveals a John Lennon the world has never seen. With ground-breaking insight into the pain, beauty and frustration that shaped the genius of modern music, John Lennon: The Definitive Biography redefines a legend.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Philip Norman hat eine gewaltige Biographie zu John Lennon geschrieben: unprätentiös, sehr lesbar und mit jenem notwendigen Zug von Besessenheit, die sich an der Liebe zur Musik entzündet.
Von Edo Reents
Im März 1966 ging der "Evening Standard" der Frage nach, wie ein Beatle so lebt. John Lennon wurde mit Heinrich VIII. verglichen - "arrogant wie ein Adler, unberechenbar, faul, desorganisiert, kindisch, rätselhaft, charmant und voller Witz" -; jeder wusste, dass man zu noch ganz anderen Vergleichen greifen müsse, wie Lennon selbst das in dem Blatt auch tat: "Das Christentum wird von uns gehen. Es wird vertrocknen und verschwinden. Daran besteht kein Zweifel. Es wird sich erweisen, dass ich recht habe. Wir sind heute populärer als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst von der Bildfläche verschwinden wird, der Rock 'n' Roll oder das Christentum. Jesus war schon in Ordnung, aber seine Anhänger waren ordinäre Dummköpfe. Sie haben es verdreht und damit für mich verdorben."
Über diese Feststellung regte sich im Heimatland der Beatles niemand auf. Vier Monate später druckte ein amerikanisches Jugendmagazin die Geschichte nach; und nur Stunden nachdem die Hefte in den Läden lagen, ging über die Agenturen die Nachricht, dass sich vom Bibelgürtel aus wie ein Flächenbrand der Boykottaufruf gegen alles, was nur irgend mit den Beatles zu tun hatte, über das Land auszubreiten beginne, das die Beatles doch längst erobert hatten. Ihre Musik wurde nicht mehr gespielt, ihre Platten wurden zerbrochen und die Geistlichkeit schleuderte Blitze der Verdammnis. Nie zuvor war ein Popmusiker so attackiert worden wie nun John Lennon. Gerade hat aber der Vatikan das vierzigste Jubiläum des "Weißen Albums" zum Anlass genommen, Lennon seinen Vergleich zu vergeben, der gleichsam aus jugendlichem Übermut heraus passiert sei.
Wer war dieser Mann, dass er es wagen konnte, das Land, welches dem Begriff der "Beatlemania" erst seine wahren, nämlich amerikanisch-monströsen Dimensionen verliehen hatte, derartig herauszufordern, so dass er später zum sogar von Präsident Nixon gefürchteten Staatsfeind avancierte? Die These von der Ersatzreligion, die Kunst bedeuten soll, ist immer trivial; aber hier stimmt sie, und Lennon war ihr Stifter.
Nachdem die Beatles im August 1966 in Gottes eigenem Land gelandet waren, stellte Lennon sich einem Pressetribunal. Statt es mit Floskeln abzuspeisen, kam er auf den entscheidenden Punkt zu sprechen: "Ich bin nicht gegen Gott, gegen die Christen oder gegen die Religion. Ich habe nicht gesagt, dass wir größer oder besser sind, ich habe uns auch nicht mit Jesus Christus als Person oder Gott als Idee oder sonst was verglichen. Ich habe mich zufällig mit einer Freundin unterhalten und dabei den Begriff ,Beatles' als etwas völlig Abstraktes verwendet - ,Beatles', das ist etwas, das andere Menschen in uns sehen. Ich habe gesagt, dass sie mehr Einfluss auf die Jugend haben als irgendetwas anderes, einschließlich Jesus, und ich habe das in einer Art formuliert, die verkehrt war, ja, ja, ja."
Um dies als Erklärung für ausreichend zu halten, war es notwendig, dass man die erkenntnistheoretische Spitzfindigkeit von "Gott als Idee" überhörte, die das, was Lennon im Sinn gehabt haben mag, freilich erst verständlich macht: der Unterschied zwischen einem Gott und dem Bild, das man sich davon macht, zwischen Musikern und dem Bild davon.
Die Beatles sind auszugraben aus Mythen und Legenden.
Es ist richtig: Schon in jenem Jahr, in dem England Fußball-Weltmeister wurde und die Platte "Revolver" erschien, die viele Kritiker für die beste Beatles-Platte und einige sogar für die beste Rockplatte überhaupt halten, war aus den Beatles etwas geworden, das vor allem in den Köpfen der Menschen existierte. Es ist heute nicht mehr möglich, die Band von diesem Abstraktum abzulösen, sie hervorzuholen, auszugraben unter der immer undurchdringlicher werdenden Schicht aus Mythen und Legenden; dergleichen gehört zur Kunst dazu. Biographische Forschung, die für den Fan immer von Interesse ist, kann ihr Facetten hinzufügen; ihre Wirkung erklären kann sie nicht.
Im Falle der Beatles ist zu sagen, dass an entsprechenden Bemühungen kein Mangel besteht. Die frühe, manches diskret auslassende Biographie von Hunter Davies gehört zum Wissens- und Halbwissensschatz wie spätere, mehr auf Brisanz setzende Versuche, etwa von Ray Coleman oder Albert Goldman; dazu die Auskünfte aus dem Umfeld der Band bis hin zu den Memoiren-Bänden von Lennons erster, von ihm nicht gerade pfleglich behandelter Frau Cynthia. Der Bedarf zur zentralen Figur dürfte nun und für vermutlich sehr lange Zeit gedeckt sein. Philip Normans Biographie "John Lennon" ist eine gewaltige, auf solidem Fundament, nämlich auf Normans eigenem, 1981 erschienenem Beatles-Buch "Shout!" fußende Kraftanstrengung, die anknüpft an den alten Zugang: "Johns Fehler wurden klar benannt, aber es wurde deutlich, dass er einen großen Einfluss auf die Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts ausgeübt hatte und letztlich ein bewundernswerter Mensch war." Nicht aus plumper Fanperspektive heraus geschrieben, die immer zur Anbetung neigt, sondern mit einer Liebe, die sich an der Musik entzündet, doch weit darüber hinausweist und Züge einer für ein solches Unternehmen auch notwendigen Besessenheit annimmt, stellt dieses Buch inmitten der sich inzwischen bis auf Randfiguren erstreckenden Rockgeschichtsschreibung einen Ausnahme- und Glücksfall dar. An Rechercheaufwand, Akribie, Ausgewogenheit und Lesbarkeit dürfte dieser, man muss schon sagen: glänzend und dabei völlig unprätentiös geschriebene und übersetzte Tausendseiter nicht zu übertreffen sein. Norman geht mit angelsächsischer Selbstverständlichkeit an die Sache heran; aber die Eingängigkeit, die er dabei erzielt, geht nicht zu Lasten des Anspruchs. Er schließt Kunst und Leben miteinander kurz; aber er weiß auch, wo das eine anfängt und das andere aufhört.
Es gab genügend Konfliktstoff, um das Ende der Band herbeizuführen.
In Lennon hat er einen ergiebigen Gegenstand, ganz gleich, ob man den Beatle intellektuell nun für voll nimmt oder nicht. Lennons um 1970 einsetzende und von seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono zumindest mit ausgelöste künstlerische Trivialisierung erschien vielen als unerträglich. Schon damals sagte ein Anhänger, die Japanerin werde nicht wegen der Kunst im Gedächtnis bleiben, die sie selbst geschaffen habe, sondern wegen der Kunst, die ihretwegen nicht geschaffen wurde. Aber die Arbeiten mit der Plastic Ono Band waren mehr als das, wofür eine überanspruchsvoll gemachte Gemeinde sie halten musste: die Geräuschkulisse einer mit Urschreitherapie und dubios-naivem Happening hantierenden Paarbeziehung. Als solche waren sie das Zeugnis einer Verstörung, die tiefer reichen musste als bis zum Band-Ende, das Lennon mit einem abgeklärten Kommentar zu überspielen suchte: "Nach Brian Epsteins Tod zerfielen die Beatles allmählich, es war ein langsamer Tod, es passierte einfach. Es ist einfach natürlich. Die Leute reden darüber, als sei es der Weltuntergang. Aber es hat sich nur eine Rockgruppe aufgelöst, nichts, was besonders wichtig wäre. Es ist ziemlich anstrengend, über Jahre hinweg mit vier Menschen zusammenzuleben, denn das haben wir gemacht. Wir haben uns gestritten und beschimpft, wir sind gemeinsam über zehn Jahre durch die Mangel gedreht worden. Wir hatten auch viele Male zusammen unsere Therapie. Man wird einfach erwachsen."
Brian Epstein, der mit seiner bis ins Detail gehenden Fürsorge, aber auch mit der kompromisslosen Prägung des netten Bandimages dem Begriff des Managers eine neue Bedeutung verliehen hatte und der 1967 plötzlich gestorben war, während die Musiker sich in Indien herumtrieben; das Eindringen neuer Frauen, die, anders als die Vorgängerinnen, nicht bereit waren, sich gängeln oder verheimlichen zu lassen; die lange in der Balance gehaltenen Differenzen unter den Musikern selbst - dies alles gab genug Konfliktstoff und beförderte das Ende der Band.
Norman aber legt noch eine andere Dimension frei, die zutiefst persönlicher Natur ist und eigentlich nur John Lennon betrifft. Dafür holt er sehr tief Luft und erzählt die ganze Familiengeschichte: der Vater Alfred, ein Schiffssteward, der sich 1946, als John sechs Jahre alt war, aus dem Staub machte, aber erst, wie hier erstmals richtig deutlich wird, nachdem die Mutter Julia ihn mit einem unehelichen Kind quasi dazu zwang; das von strenger Fürsorge beherrschte Leben bei der Tante Mimi; der Unfalltod der Mutter, zu der John sich, wie Norman glauben machen will, auf prekäre Weise hingezogen fühlte; die Halbstarkenphase der Teddy Boys, die mit einem Bein in der Kunstakademie standen und mit dem anderen in Suff, Sex und Rock 'n' Roll und aus denen sich die Band herausschälte, die mit Unterstützung der überragenden Produzentenfähigkeiten George Martins und ihrem eigenen, einzigartigen Charisma die Welt dann buchstäblich aus den Angeln hob. Diese Erfahrungen führten bei John zu einer Heftigkeit und Intensität, ohne die Rockmusik nicht auskommt, die sie aber auch bedrohen, weil sie auf die Dauer menschlich nicht tragfähig sind.
Man neigt dazu, ein mächtiges Imperium von dessen Ende her zu betrachten, auf Verfallssymptome zu achten, die sich bei den Beatles früh einstellten, weil ihre Leistung und ihre Akzeptanz im Grunde schon vor dem letzten Konzert im August 1966 in San Francisco nicht mehr steigerbar waren. Norman berichtet, wie die weiblichen Besucher in dem berühmten Cavern Club während eines Auftritts am 19. Februar 1963 bei der Nachricht, dass die allererste Platte "Please, Please Me" Platz eins erklommen habe, in Tränen ausbrachen, weil sie wussten, dass die vier damit in eine andere Umlaufbahn eingetreten waren und sich hier so schnell nicht wieder blicken lassen würden.
Der Rest ist bekannt - und auch wieder nicht. Norman zeigt, was dem Mythos von der unterdrückten oder korrumpierten Hochbegabung eigentlich zuwiderläuft: dass es nicht Yoko Ono war, die Besitz ergriffen hätte von John Lennon; es war, auf eine schon krankhafte Weise, umgekehrt. Wir haben uns dabei an die Lesart gewöhnt, dass die übrigen drei Beatles von Anfang an etwas gegen die überspannt wirkende Yoko Ono hatten. Norman kann glaubhaft machen, dass sie es eine Zeitlang durchaus mit Höflichkeit und Toleranz versuchten und auch nicht protestierten, als Lennon mit ihr zu den Plattenaufnahmen in den Abbey-Road-Studios auftauchte. Es liegt deshalb nahe, dass John Lennon sich diese Frontstellung eher eingebildet hat. Tatsache ist, dass er auf sie seine und Yokos spätere Heroinsucht zurückgeführt hat und sich auf seinen Soloplatten das Recht nahm, Paul McCartney mit ehrabschneiderischen Anspielungen bis aufs Blut zu reizen. Seine berühmte Floskel "wegen all der Dinge, die die Beatles uns angetan haben" dokumentiert nicht nur eine Selbstgerechtigkeit, die man jedermann zugestehen mag; auf befremdliche Weise deutet sie auch auf einen schizophrenen Zug hin, denn die Beatles waren ja John Lennon.
Lennon war ganz ohne Zweifel das Zentrum dieses Kraftfeldes, aber auch sein dunkler Fleck. Norman beschreibt ausgesprochen hässliche Ausbrüche des unter Alkohol unberechenbar Werdenden. Aber dieser Mann hatte auch rührend fürsorgliche Seiten und wird von denen, die ihn gut kannten, als außergewöhnlich mitfühlend beschrieben. Er war jedenfalls die einflussreichste Persönlichkeit dieses Clans, ohne die es nicht halb so viel Gesprächsstoff gegeben hätte. Der musikalisch absolut gleichrangige, ungleich diplomatischer auftretende Paul McCartney, der emsig-introvertierte George Harrison und der bodenständige, durch nichts zu beeindruckende Ringo Starr waren ebenbürtige Partner, wenn Ebenbürtigkeit auch bedeutet, es lange genug in einem Quartett auszuhalten, das anfangs wohl wirklich noch mit unbeschwerter Freude agierte, rasch auf Hochspannung getrimmt wurde und durch die ins Grenzenlose gehenden Erwartungen und Projektionen von außen irgendwann kaum noch manövrierfähig war.
Es wurde oft gesagt, dass die Beatles mehr waren als die Summe ihrer Mitglieder; aber sie konnten dies nur werden, weil John Lennon es war, der die Band gegründet, groß gemacht und schließlich zerstört hat - oder sie einfach hat enden lassen, weil er spürte, dass sie ihr Pulver verschossen hatte. Bemerkenswert hellsichtig, ja, weise, nahm er damals Abschied von den sechziger Jahren, weil er spürte, dass nun etwas Neues kommen müsse. So fiel es ihm zu, das Ende der Band eher aus freien Stücken als wegen Yoko einzuleiten. Ein Ende, das McCartney, der dies um sein Leben gern verhindert hätte, dann erst im April 1970 und sehr zu Lennons Ärger verkündete.
Ein neuer Blick auf den Weg gemeinsam mit Yoko Ono.
Zu dieser Zeit waren die Lennons bei dem kalifornischen Urschrei-Therapeuten Arthur Janov in Behandlung, der über Johns Zustand eine bestürzende Diagnose abgab: "Der Schmerz, unter dem er litt, war enorm. So schlimm, wie ich es bisher noch nicht erlebt hatte. Ein Mensch, den die ganze Welt bewunderte, und das hatte nichts an seiner Situation geändert. Mitten in all dem Ruhm und Reichtum stand ein kleines, einsames Kind." Deswegen musste John Lennon noch einmal ganz von vorne anfangen. Die Jahre bis zu seiner Ermordung durch einen Verrückten namens Mark David Chapman am 8. Dezember 1980 verbrachte er überwiegend in New York. Nach fünf Solojahren, die durchaus hochwertige, mitreißende Musik abwarfen, verlor er jede Ambition und kümmerte sich in seiner riesigen Wohnung im New Yorker Dakota Building um seinen 1975 geborenen zweiten Sohn Sean. In dieser Zeit, die durch das berüchtigte "lost weekend", eine praktisch anderthalb Jahre währende Sauftour mit dem Rockadel, unterbrochen wurde, waren für ihn eigentlich nur zwei Fragen von Interesse: Würde es eine Wiedervereinigung der Beatles geben? Und würde Lennon die Vereinigten Staaten von Amerika, die ihn mit empörenden, bigotten Ausweisungsbescheiden in Atem hielten, doch noch kleinkriegen?
In Normans Darstellung gewinnt der Weg Yoko Onos Seite noch einmal andere Kontur und Würde. Vieles von dem, was die beiden seit 1969 trieben - die Bed-Ins im Amsterdamer Hotel, bei denen sie der gesamten Weltöffentlichkeit quasi Audienz gewährten, das Versenden von Eicheln an hochrangige Politiker als Aufforderung zum Frieden, überhaupt ihr strikt pazifistisches Gebaren -, mag uns Heutigen kitschig vorkommen; es wurde schon damals verächtlich gemacht als "Ego-Trip zweier reicher Gammler". Norman hält sich mit solchen Bewertungen zurück, ohne die krassesten Entgleisungen zu unterschlagen, und macht plausibel, dass die Lennons es mit ihrem kräftezehrenden Engagement, von dem viele profitiert haben, einfach ernst meinten. Es speiste sich bei John freilich nicht nur aus ideologischen Überzeugungen, sondern auch aus Kränkungen und Verlusterfahrungen, vor allem aus der Verzweiflung darüber, dass ihm die wichtigsten Menschen weggestorben waren: die Mutter, Stu Sutcliffe, frühes Bandmitglied, und Brian Epstein.
So wurde John Lennon zu dem, was Sean Lennon in einem bewegenden "Postscriptum", zu dem der Biograph ihn einvernommen hat, als "Songwriter der Unsicherheit" bezeichnet: "Sich als Mann unsicher zu fühlen und sich selbst zu hinterfragen, wie es mein Da in seinen Songs getan hat, ist ein postmodernes Phänomen. (. . .) Das ist etwas, was ihm eigen ist: dieses Gefühl der Unsicherheit, das so viele andere Songwriter zu kopieren versucht haben. Er hat das erfunden." Lennon hat dieses Songwriting der Unsicherheit zur Vollendung geführt und mit McCartneys Unterstützung massentauglich gemacht. Darin bestand sein Genie. Aus dem Zorn des "Working Class Hero" und der Verzweiflung des "Jealous Guy", wie er sich nach 1970 in Szene setzte, ist er genauso herauszuhören wie aus den phantasievoll-vergrübelten Liedern der Beatles-Ära und den Friedens- und Weihnachtsliedern: John Winston Lennon, dieser immer ein wenig vorwitzige Liverpooler Junge, der anfangs nie seine Brille tragen wollte und der trotz oder sagen wir besser: wegen seiner Kopflastigkeit nichts so sehr liebte wie den Rock 'n' Roll.
Philip Norman: "John Lennon". Die Biographie. Aus dem Englischen von Reinhard Kreissl. Droemer Verlag, München 2008. 1024 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'Reading this book brings the John Lennon I knew vividly back to life.' Bill Harry, founder of Mersey Beat
'This is the best Lennon book so far' The Word
'Norman has written about Lennon twice before but he has uncovered much new material in his research for this impressive and highly readable book... It is greatly to Norman's credit as a biographer that he does justice to all of (Lennon's legacy) in a book whose 854 pages simply fly by.' Sunday Times Culture
'Can there be more to find out (about Lennon)? And, can Philip Norman, the author of the new 300,000 word John Lennon: The Life, be serious when he tells The Word magazine, "Lennon deserves a real biography, as if he were John Keats or Mahatma Ghandi. Not a pop person but a major towering presence in his century?" The answer to both questions is empahatically yes...And yes, Norman has unearthed some startling things.' The Independent
'Although more than 800 pages long, this book is nicely paced, well researched and will not disappoint.'
Glasgow Evening Times
'Reading this book brings the John Lennon I knew vividly back to life.'
Bill Harry, founder of Mersey Beat
'This is the first serious Lennon biography for 20 years and unlike Albert Goldman's bilious effort in the 80s, Norman's style is trustworthy, contextual, and plainly told, yet with enough splashes of historical colour...'
The Times
'A well-written book and almost everything you could want to know [about Lennon] is in there.'
Oxford Times
The New Statesman called the book 'magnetic'.
'Philip Norman's style is compelling', Irish Times
'Norman's mesmerising biography'. Irish Examiner
'Meticulously researched, compulsively readable book.'
Sunday Times Culture magazine
'The Rock biography of the Year.'
Metro
'The best all-round Lennon biography.'
Sunday Herald Magazine
'This is the best Lennon book so far' The Word
'Norman has written about Lennon twice before but he has uncovered much new material in his research for this impressive and highly readable book... It is greatly to Norman's credit as a biographer that he does justice to all of (Lennon's legacy) in a book whose 854 pages simply fly by.' Sunday Times Culture
'Can there be more to find out (about Lennon)? And, can Philip Norman, the author of the new 300,000 word John Lennon: The Life, be serious when he tells The Word magazine, "Lennon deserves a real biography, as if he were John Keats or Mahatma Ghandi. Not a pop person but a major towering presence in his century?" The answer to both questions is empahatically yes...And yes, Norman has unearthed some startling things.' The Independent
'Although more than 800 pages long, this book is nicely paced, well researched and will not disappoint.'
Glasgow Evening Times
'Reading this book brings the John Lennon I knew vividly back to life.'
Bill Harry, founder of Mersey Beat
'This is the first serious Lennon biography for 20 years and unlike Albert Goldman's bilious effort in the 80s, Norman's style is trustworthy, contextual, and plainly told, yet with enough splashes of historical colour...'
The Times
'A well-written book and almost everything you could want to know [about Lennon] is in there.'
Oxford Times
The New Statesman called the book 'magnetic'.
'Philip Norman's style is compelling', Irish Times
'Norman's mesmerising biography'. Irish Examiner
'Meticulously researched, compulsively readable book.'
Sunday Times Culture magazine
'The Rock biography of the Year.'
Metro
'The best all-round Lennon biography.'
Sunday Herald Magazine