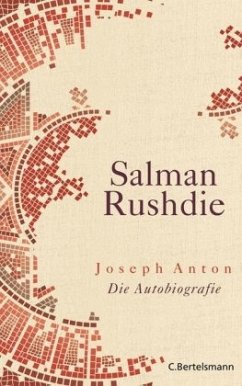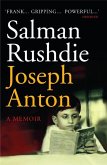Vom Tod bedroht und vogelfrei
Am Valentinstag, dem 14. Februar 1989, erhält Salman Rushdie den Anruf einer BBC-Reporterin und erfährt, dass der Ayatollah Khomeini ihn »zum Tode verurteilt« hat. Zum ersten Mal hört er das Wort »Fatwa«. Sein Vergehen? Einen Roman mit dem Titel »Die satanischen Verse« geschrieben zu haben, dem vorgeworfen wird, sich »gegen den Islam, den Propheten und den Koran« zu richten.
So beginnt die außergewöhnliche Geschichte eines Schriftstellers, der gezwungen wird, unterzutauchen und in ständiger Begleitung einer bewaffneten Polizeieskorte von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu ziehen. Als die Polizei ihn auffordert, sich einen Decknamen zuzulegen, wählt er eine Kombination aus den Vornamen seiner Lieblingsschriftsteller Conrad und Tschechow - Joseph Anton.
Was heißt es für einen Schriftsteller und seine Familie, über neun Jahre lang mit einer Morddrohung zu leben? Wie gelingt es ihm, weiter zu schreiben? Wie beginnt und endet für ihn die Liebe? Wie fest hat die Verzweiflung sein Denken und Handeln im Griff, was lässt ihn straucheln, und wie lernt er, Widerstand zu leisten? Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine beeindruckende Geschichte; es ist die Geschichte eines der entscheidenden Kämpfe unserer Zeit: der Kampf um die Meinungsfreiheit. Rushdie erzählt vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz und von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Geheimdienstchefs, Verlegern, Journalisten und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte.
Ein einzigartig offenes, aufrichtiges Buch: fesselnd, provokant, bewegend und lebenswichtig. Denn das, was Salman Rushdie durchlebt hat, ist der erste Akt eines Dramas, das sich tagtäglich irgendwo auf dieser Welt vollzieht.
Am Valentinstag, dem 14. Februar 1989, erhält Salman Rushdie den Anruf einer BBC-Reporterin und erfährt, dass der Ayatollah Khomeini ihn »zum Tode verurteilt« hat. Zum ersten Mal hört er das Wort »Fatwa«. Sein Vergehen? Einen Roman mit dem Titel »Die satanischen Verse« geschrieben zu haben, dem vorgeworfen wird, sich »gegen den Islam, den Propheten und den Koran« zu richten.
So beginnt die außergewöhnliche Geschichte eines Schriftstellers, der gezwungen wird, unterzutauchen und in ständiger Begleitung einer bewaffneten Polizeieskorte von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu ziehen. Als die Polizei ihn auffordert, sich einen Decknamen zuzulegen, wählt er eine Kombination aus den Vornamen seiner Lieblingsschriftsteller Conrad und Tschechow - Joseph Anton.
Was heißt es für einen Schriftsteller und seine Familie, über neun Jahre lang mit einer Morddrohung zu leben? Wie gelingt es ihm, weiter zu schreiben? Wie beginnt und endet für ihn die Liebe? Wie fest hat die Verzweiflung sein Denken und Handeln im Griff, was lässt ihn straucheln, und wie lernt er, Widerstand zu leisten? Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine beeindruckende Geschichte; es ist die Geschichte eines der entscheidenden Kämpfe unserer Zeit: der Kampf um die Meinungsfreiheit. Rushdie erzählt vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz und von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Geheimdienstchefs, Verlegern, Journalisten und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte.
Ein einzigartig offenes, aufrichtiges Buch: fesselnd, provokant, bewegend und lebenswichtig. Denn das, was Salman Rushdie durchlebt hat, ist der erste Akt eines Dramas, das sich tagtäglich irgendwo auf dieser Welt vollzieht.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schadenfreude bekennt Nils Minkmar nach der Lektüre dieses Buchs: Schadenfreude mit den Islamisten, die Rushdies Kopf nicht bekamen und Rushdies Leben nicht zerstörten, obwohl sie auf dem besten Wege waren und bis heute nicht nachlassen. Dennoch: dass Rushdie dieses Buch schreiben konnte, ist für Minkmar "das schönste Scheitern der Islamisten". Minkmar liest "Joseph Anton" nicht nur als Erinnerung an die dunklen Jahre der Morddrohung: Es ist für ihn ein Panorama unserer Gegenwart, in der sich die Bedrohung des Islamismus immer dunkler über dem Himmel des Westens und seiner Werte zusammenzog. Rushdie selbst erinnert an das Bild der Vögel in Hitchcocks gleichnamigen Film und daran, dass man den ersten Vogel, der sich auf das Klettergerüst bei den spielenden Kindern setzt, erst im Nachhinein als "Vorboten" erkennt. Auch als unbequeme Lektüre schildert Minkmar "Joseph Anton", denn Rushdie scheut sich nicht, all jene namhaft zu machen, die in den Jahren der Fatwa moralisch versagten. Deutsche Politiker gehörten dazu.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Fatwa, Frauen, frühes Kalifat - der britische Schriftsteller schont in seiner Autobiographie niemanden, am wenigsten sich selbst
Ein Schriftsteller kann nicht beides haben: ein vollendetes Leben und ein vollendetes Werk.
Stell dich, weißer Mann, deine Stadt ist umzingelt", hieß es 1984 auf einem Graffito in Alice Springs, in der Mitte des australischen Outback. Salman Rushdie hatte den Satz während einer Reise mit Bruce Chatwin in seinem Notizbuch festgehalten. Als sich Rushdie fünf Jahre später an das Graffito erinnert, ist er selbst umzingelt und Chatwin gerade an Aids gestorben. Nur, und das macht hier einen Unterschied, ist Rushdie kein weißer Mann. Oder, was vielleicht wichtiger ist, hat sich bis dahin nicht als solcher gefühlt.
Der Tag der Erinnerung an Australien ist jener Tag im Februar 1989, an dem der Ajatollah Chomeini sein Todesurteil, die sogenannte Fatwa, über Salman Rushdie verhängte und mit einem Kopfgeld von drei Millionen Dollar anreicherte. Rushdie war an diesem Tag auf dem Weg in die griechisch-orthodoxe Kathedrale der heiligen Sophia der Erzdiözese von Thyateira und Großbritannien, um an einem Gedenkgottesdienst für Chatwin teilzunehmen. Und als er dem "in sonorem, salbungsvollem Griechisch" abgehaltenen Ritual in der Kirche folgt, versteht er nur Bahnhof. "Bla, bla, bla Bruce Chatwin, intonierten die Priester, bla, bla Chatwin, bla, bla."
Das ist sein generelles, fast möchte man sagen: konstitutionelles Handicap - Rushdie hat kein Ohr, findet keinen Zugang zur Praxis der Religionen in ihren Ritualen. Das ging ihm schon als kleiner Junge so, als ihn sein Vater einmal in Bombay am Tag des Ramadanfestes auf den Gebetsplatz mitgenommen hatte. Und das war auch in Australien so, als er mit Chatwin den Ayers Rock, den heiligen Berg der Aborigines, bestiegen hat. Dafür begann er in Australien aber zu verstehen, wie "Die satanischen Verse" geschrieben werden konnten, das Buch, welches Chomeinis Zorn erregte, weil es eine Überlieferungsvariante der Texte des Propheten literarisch durchspielt, die mit der kanonischen Fassung des Korans kollidiert. Dass das literarische Gedanken- und Traumspiel um die Verehrung oder Nicht-Verehrung dreier einst in Mekka in Stein gehauener Göttinnen als Blasphemie aufgefasst werden könnte, war Rushdie während des Schreibens nie in den Sinn gekommen. Dementsprechend unvorbereitet trifft ihn die Heftigkeit der Reaktion der muslimischen Orthodoxie. Was ihm in der griechisch-orthodoxen Kathedrale aber sofort klar wird, ist sein tiefsitzender Affekt gegen den mysteriösen Wortreichtum der religiösen Rituale.
Umzingelt von Paparazzi, Journalisten, Polizisten und Schriftstellerkollegen wie Paul Theroux, wird ihm das Unverständliche der Religionen verständlich. Die Religionen sind kein Sprachspiel, sie sind ein Kampf um Leben und Tod, und dem muss er, Salman Rushdie, sich jetzt stellen. Das ist der Ausgangspunkt seiner jetzt in 27 Ländern gleichzeitig erscheinenden Autobiographie mit dem Titel "Joseph Anton" - ein fünfzehnseitiger Prolog, der einem in seiner Welthaltigkeit den Atem verschlägt. Kein Satz ist hier Luft, Pause. Es folgt Information auf Assoziation, Australien auf Bombay, ein Mann vom "Daily Telegraph" auf Paul Simon. Darin wird auch noch das Leben seiner ersten beiden Frauen im Kurzporträt ohne Kitsch oder Häme, aber auch ohne Schonung erzählt.
Es ist der Prolog zu einem Buch, in dem Salman Rushdie versucht, sich selbst Aufschluss über seine Grundlagen zu geben. Rushdie weiß dabei um seine Fähigkeiten, er würde aber nie auf die Idee kommen, dass er einem Stoff oder Thema schon deshalb gewachsen sei, weil er, Rushdie, es behandelt. Das unterscheidet ihn radikal vom nicht nur unter Schriftstellern grassierenden aktuellen Ich-Darwinismus. Alles, was er kann und tut, seine Themen, seine Affekte, seine Lektüren resultieren aus Beziehungen zu anderen Lebewesen. Deshalb ist auch nur logisch, dass er von sich nur in der dritten Person spricht. Er, Rushdie, hat dieses Buch geschrieben und nicht irgendein Ich-Idiot. Ein Buch, das schon in seinen ersten Worten Rushdies Ambivalenz gegenüber den Welten des Mysteriösen zeigt, so dass es unmöglich wird, den Text nur unter der verhärteten Frontstellung zwischen Aufklärung und Religion zu lesen.
"Die erste Krähe" ist der Prolog überschrieben, und die Krähe ist hier das beseelte Böse in Tiergestalt. Man kann auch Chomeini zu ihr sagen, und natürlich bleibt sie nicht lange allein. In Scharen fallen sie in einen Schulhof in Kalifornien ein und singen das Lied vom stolzen muslimischen Volk, das das Todesurteil über Salman Rushdie verhängt. Man kann diese Krähe als Verbeugung vor den Aborigines, den wichtigsten Vertretern eines aktuellen, lebendigen Animismus, lesen. Zum anderen stehen die übel besetzten Krähen aber auch für Rushdies Abschied vom Osten, von Asien. Asien ist der einzige Kontinent, auf dem Krähen in der Mehrzahl der Gründungsmythen als Schöpfungs-, Weisheits- oder Glücksvogel positiv besetzt sind. Ihre üble Konnotation als Todesvogel oder Ungeziefer erfahren sie erst auf dem Weg in den Westen.
Ein Weg, den Rushdie mit dreizehn Jahren ganz freiwillig beschreitet. Von Bombay geht er nach England, auf ein Internat in Rugby. Dort lernt er den allgegenwärtigen britischen Rassismus kennen. Er weiß sich zu wehren und bringt sich mit Tricks, die er selbst als machiavellistisch bezeichnet, in die Lage, einen englischen Mitschüler im Handel um einen Ledersessel übers Ohr zu hauen. Später wird er diesen Schüler dann als Politiker der rassistischen National Front in einer Zeitung wiederentdecken. Rushdie wird auf der Schule trotz des Rassismus nicht zum Rebellen. Er entdeckt für sich die Möglichkeit der freien Entfaltung seiner Gedanken unter dem Regime der konservativen Form. Ein Prozess, der sich im Geschichtsstudium in Cambridge am King's College fortsetzt. Weil sich zu der Zeit die Professoren um jedes Thema kümmern mussten, solange sich auch nur ein Student dafür interessiert, kommt er zu seinem Lebensthema: Mohammed, der Aufstieg des Islam und das frühe Kalifat.
Arthur Hibbert, einer der drei am College für Geschichte zuständigen Professoren, wird dabei in seinem Habitus zu einem der bedeutendsten Vorbilder des Schriftstellers Rushdie. Hibbert gehörte einer schon damals aussterbenden Generation von Gelehrten an. Er veröffentlichte wenig, war außerhalb des College völlig unbekannt, dafür aber ein herausragender Lehrer. "Sie dürfen erst über Geschichte schreiben, wenn Sie die Menschen reden hören", ermahnt er Rushdie und lässt ihn seine Forschungen über Mohammed treiben. Und was dabei herausgekommen ist, ist die Sensation dieses Buches. In der kurzen Passage, sie umfasst sechs Seiten, in der er vom frühen Leben Mohammeds und den Gründen seines Erfolgs erzählt, wird Rushdie in der Literatur zu dem, der Spinoza in der Philosophie ist. So wie sich Spinoza endgültig selbst aus der jüdischen Gemeinde herausgeschrieben hatte, indem er die Bibel als ein Buch wie jedes andere las, so schreibt sich Rushdie schon in Cambridge aus der Welt des Islam, indem er die Geschichten um Mohammed materialistisch liest.
Wie tief er dabei in die Geschichte eingestiegen ist, zeigt er durch die Erwähnung des marxistischen Orientalisten Maxime Rodinson. Rodinson war ein in Paris lehrender Historiker, Sohn russisch-polnischer Juden, die in Auschwitz ermordet wurden, der über das Verhältnis von Islam und Kapitalismus forschte und früh erkannte, dass in dem Verhältnis ein paradoxes Problem liegt. Denn am Gründungsvater, am erfolgreichen Händler Mohammed, kann der grundlegende Antikapitalismus des Islam nicht gelegen haben. Rushdie baut die Überlegungen Rodinsons so fließend in seine Geschichte um den Händler Mohammed ein, dass einem beim Lesen der Sprengstoff des Konflikts fast entgeht. Ganz entgehen kann er einem nicht, weil man von der Fatwa weiß, aber Rushdie schafft im Buch etwas sehr Schönes. Ihm gelingt es, in Ton und Farben der sechziger und siebziger Jahre einzutauchen, den wirklich säkularen Jahrzehnten, bevor in den achtziger Jahren die Religion zurückkam.
Und das ist eine andere Linie dieser Erinnerungen: Rushdies tiefe Verwicklung in die Popkultur des Westens. Er gehört zwar zu den oft intellektuell suspekten Leuten, welche die Rolling Stones besser finden als die Beatles. Dafür kennt er aber Captain Beefheart und hört Velvet Underground. Musik, die man gut beim Lesen hören kann, weil sie genauso antidialektisch gemacht ist, wie Rushdies Buch gedacht ist. Rushdie schont und schützt nämlich außer seinen Kindern niemanden. Sich selbst am wenigsten. Wenn er sich wieder einmal freut, dass er mehr verdient als andere, schreibt er das auch. Ebenso wenig verschweigt er seinen Stolz, wenn ihn die Bewunderung anderer Männer für seine vierte Frau, ein bildschönes Model, erregt. So eine Frau kriegt eben nur Rushdie. Vor der Scheidung auch dieser Ehe schützt aber auch das nicht. Ein Schriftsteller kann nicht beides haben: ein vollendetes Leben und ein vollendetes Werk. Er muss sich entscheiden. Rushdie hat sich für das Werk entschieden und dabei schmerzlich bemerkt, dass das Werk nicht autonom ist. Das Werk ist das, was durch seinen Autor hindurchgegangen ist, und wenn es als Werk da ist, ist es der Welt ausgeliefert, die in das Werk eingegangen ist. Welthaltiger im ganzen Sinn des Wortes hat das noch nie jemand so beschrieben wie Rushdie. Konnten bisher Bücher wie "Don Quijote" oder "Moby Dick" aus dem lokalen Kontext zur Weltliteratur werden, so bildet diese Autobiographie zumindest die Prolegomena zu einer künftigen, wirklichen Weltliteratur, weil in den Autor schon eine große Welt eingegangen ist.
CORD RIECHELMANN
Salman Rushdie: "Joseph Anton. Autobiografie". Übersetzt von Bernhard Robben und Verena von Koskull. Bertelsmann, 720 Seiten, 24,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Salman Rushdie hat sein bestes Buch geschrieben, eines der größten über unsere so schwer zu deutende Zeit, ein Meisterwerk." Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Zeitung