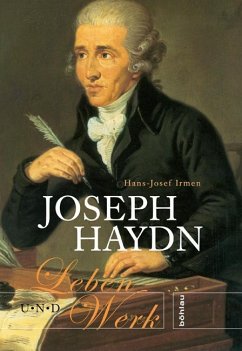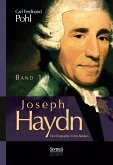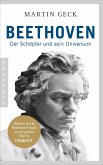Joseph Haydns Lebenslauf (1732-1809) verlief entlang einer kulturhistorisch faszinierenden Wegstrecke. Als Sohn eines Wagenbauers stammte Haydn aus Handwerker-Verhältnissen, die ihn Zeit seines Lebens nachhaltig geprägt haben. Als er mit acht Jahren nach Wien kam, entwickelte er sich dort in den folgenden zwanzig Jahren vom talentierten Chorknaben zum jungen Sänger, Instrumentalisten und Komponisten. 1761 wurde er Kapellmeister am Hofe der ungarischen Fürsten Eszterházy, in deren Diensten er 30 Jahre wirkte. In den 1790er Jahren führten ihn zwei ausgedehnte Reisen nach London, wo er große Erfolge als Komponist und Dirigent feiern konnte. Überragende musikalische Bedeutung erlangte Haydn vor allem mit seinen Streichquartetten und Sinfonien. Er entwickelte eine musikalische »lingua franca«, die ganz Europa sprechen lernte und die die Basis für das Schaffen Mozarts und Beethovens legte, besonders für deren Sinfonik. Hans-Josef Irmen zeichnet in seiner Biographie ein kenntnisreiches, lebendiges und zugleich kritisches Bild des »Vaters« der klassischen Sinfonie. Er schildert die ernüchternden Lebensumstände des großen Komponisten ebenso wie ihre Verwobenheit in eine reiche künstlerische Epoche. Der begeisterte Haydn-Fan sieht die herausragende Bedeutung der Musik darin, daß man sie in der ganzen Welt versteht, weil sie ausgewogen, klar, persönlich, aufrichtig, aber auch gewitzt und herzerfrischend natürlich ist.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Viel Vergnügen und reichlich unerwartete Einblicke hat die Lektüre von Hans-Josef Irmens Hayden-Biografie dem Rezensenten Dieter Hildebrandt bereitet. Keine leichte Aufgabe sei die Aufarbeitung dieser außerordentlichen Vita, doch in diesem Fall durchaus gelungen, befindet er. Zwar verzichte der Musikwissenschaftler und Dirigent Irmen weitestgehend auf Informationen und Anekdoten aus Haydens Privatleben, dafür entwerfe er jedoch ein spektakuläres historisches Panorama, welches der Rezensent gerne mit der Überschrift "Hayden in seiner Zeit" überschrieben hätte. Bestens unterhalten fühlt sich Hildebrandt von der "materialistischen Musikgeschichtsschreibung" des Autors, die ihm zufolge eine lebendige Einführung in das musikfanatische Wien des 18. Jahrhunderts bietet. Erfreut kommentiert er auch die polemischen Seitenhiebe des Professors, dessen Buch sich so gar nicht akademisch lese.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH