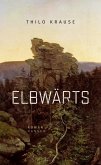Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2011 Hoch oben auf dem Feuerwachturm eines Militärstützpunktes steht ein Junge und beobachtet, wie die Sonne lichte Tupfer auf die Landschaft wirft; im Hintergrund das leichte Sirren eines alten Kofferradios. Die Ruhe aber ist nur von kurzer Dauer, denn etwas im Jungen gerät aus den Fugen. In seinen Ohren saust es, sein Herz rast. Die Dinge zeigen sich überkonturiert. Unten im Ort, der wie ein Niemandsland zwischen den Grenzen liegt, herrscht triste Normalität. Die Menschen gehen in die Kirche und prozessieren stolz beim Schützenfest. Von den Dingen, die um sie herum passieren, nehmen sie kaum Notiz. Den Jungen aber treiben Schwindelschübe hinein in einen Zitterzustand. Er sieht Kinder, bewaffnet mit Gewehren, Totempfähle, Asylanten, die wartend in ihren Baracken kauern. Er begreift, daß er anders ist, und schöpft daraus neuen Mut. Fortan begegnet er der Welt mit einem verängstigten Staunen, in der Hoffnung, daß sie mehr bereithält, als derschnelle Blick erhaschen kann. Die Enge des Dorfes schnürt ihm zunehmend die Luft ab. In einer Nacht, in der die Bilder rauschen, plant er sein Fortgehen. Das Wagnis, zu schauen, was möglich ist: ein Debüt, das funkelt, flirrt und fiebert.

In seinem düsteren Debütroman "Junge" erzählt Sebastian Polmans von einer Kindheit am Niederrhein - und dem Traum, ihr zu entkommen.
Dieser kurze Roman ist anders als das, was sonst so "vorgelegt" wird. Nichts Lautes, Grelles, Schockierendes, auch nichts Witzelndes. Sondern Stille und Ernst - Unruhe aber schon. Berichtet wird von nur wenigen Tagen in einem August, der rund fünfzehn Jahre zurückliegen dürfte, der Junge, um den es geht, war damals so um die zwölf. Kaum schon Pubertäres - auch dies ist hier nicht der Punkt. Nur einmal - "das Mädchen auf dem Roller, mit den schönen Locken" - blitzt es auf. Räumlich sind wir im Umkreis eines Dorfs am Niederrhein in der Nähe der Grenze zu Holland. Dies Räumliche ist aber kontingent: Das Geschilderte könnte ebenso anderswo sein, es geht um Allgemeineres, nicht um Regionalliteratur.
Erzählt wird in der dritten Person - "der Junge" -, und dies ganz aus dessen Perspektive, nur gelegentlich ein zusätzlicher Blick von außen. Und keine erzählerische Distanz, etwa aus dem Rückblick: Alles wird so erzählt, wie es jetzt ist, im Augenblick des Erzählens selbst. Dieses Erzählen ist, gerade weil es eher locker festgehalten wird, geschickt, unangestrengt kunstvoll. Locker ist der Erzähler auch in seiner Sprache, nicht weit entfernt von der des Jungen. Und der Autor selbst, Jahrgang 1982, ist ja nun wirklich jung, und er schreibt, wie es scheint, aus erster Hand.
"Am Anfang dieses Herzrasen", so lautet der Titel des ersten Abschnitts. Wirklich ist in dem Buch, das kaum Handlung oder gar Action hat, sogleich etwas Unheimliches. Und es wird außerordentlich intensiv und genau, poetisch genau, erzählt. Der Erzähler beschreibt eine seltsame innere Krise. Dabei evoziert er aber immer nur, was er wahrnimmt: Er führt, ohne zu analysieren, einfach vor.
Es beginnt mit dem Feuerwachturm: Der Junge hat die Aufgabe, die Gegend zu beobachten. Eine Waldidylle ist diese übrigens nicht: Da ist die Grenzstraße, da sind Polizisten, und britische Düsenjäger steigen in der Nähe übend auf. In dem Jungen aber, in seiner unruhigen Einsamkeit, ist plötzlich "dieses Gebrüll" oder auch "dieses Rauschen": "Das Rauschen in seinem Kopf drängte vorwärts und wurde lauter. Jetzt schrie er selbst. Aber alles war still." Vorzeitig radelt er nach Hause, aber eigentlich will er gar nicht nach Hause, er gerät in ein Gelände am Flugplatz, dann, am Waldrand, in ein Containerlager für Asylbewerber, erlebt dort Seltsames - er realisiert aber auch von sich aus immer wieder Symptome, die ins Klinische gehen, indem er Dinge wahrnimmt, die nicht sind -, schließlich schaut er noch bei den Großeltern herein, die in demselben Dorf wohnen. Der Großvater ist gerade dabei, Kaninchen zu schlachten, was den Jungen völlig verstört. "Nimm deine Hand weg", sagt er zum Großvater, wie der sie ihm auf die Schulter legt. Der Großvater stirbt einige Tage danach unerwartet - und eigentlich "passiert" hier nur dies.
Aber der Junge ist davon wenig berührt. Näher stand ihm ohnehin die Großmutter, die auch immer wieder "Pass auf dich auf!" sagt. Er ist das einzige Kind. Darunter leidet er, Einsamkeit also. Die frömmelnde Mutter, die aktiv an der Messe teilnimmt, in der sie vorliest, ist ihm fremd, obwohl sie ihn gelegentlich streichelt und matt verteidigt ("Der Junge ist, wie er ist"). Die Messe erfährt er als geradezu feindselig. Der Vater geht im Schützenverein und in seiner Fußballwelt auf, oft ist er auch mehr oder weniger alkoholisiert. Und dann ist da im Dorf noch der undeutliche japanische Freund Hiko, den er zuletzt noch aufsucht, bevor er aufbricht.
Vom Aufbruch aber sagt er auch Hiko nichts. Auch der ist ihm kein wirkliches "Du" (so ist ein Abschnitt sprechend überschrieben). Nur dies ist dem Jungen klar: Er muss weg, sofort und weit weg, bis nach Tokio zumindest. Mit "Tokio" ist auch der letzte Abschnitt überschrieben, der gleichsam auf realistische Weise, auf dem Fahrrad nämlich, ins Irreale geht: "Kurz schloss er die Augen, da packte ihn wieder der Schwindel, und für einen Moment sah er sich schwebend im All, irrsinnig fuchtelnd mit Armen und Beinen, Lichtjahre entfernt von der leuchtenden Weltkugel, die ihm wie ein aufgedunsener, blauer Ballon im Weltraum vorkam." Schließlich stürzt er, bleibt, nur wenig von seinem Dorf entfernt, im Dreck und Regen liegen. Und wieder "schrie er fast, so als läge jemand ganz nah bei ihm, dem er ins Gesicht schreien wollte". Dann wird er still und dreht sich um - "das Gesicht in den Himmel gerichtet. Gleich würde er die Augen öffnen."
So, sehr ergebnislos oder sehr offen, verlieren wir den Jungen aus dem Blick. Am Ende wissen wir nicht einmal, wie er heißt. Es sind in dem Buch einige Fotos. Ihn selbst aber, den Jungen, wie er damals war, zeigt keines. Die Fotos zeigen jedoch, dass Sebastian Polmans, Träger des Jürgen-Ponto-Förderpreises 2011, in diesem Roman von sich selbst erzählt. Gegen Kindheitserinnerungen als solche kann man ja nun nichts sagen. Und in diesem Fall ist der, der sich erinnert, vom Erzählten wahrlich noch nicht weit entfernt. Doch dieser Roman ist ein gutes, ein atmosphärisch intensives Debüt.
HANS-MARTIN GAUGER
Sebastian Polmans: "Junge". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 195 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Als lockendes Versprechen auf mehr nimmt Roman Bucheli den, wie er schreibt, "hochpoetischen" Debütroman von Sebastian Polmans. So karg und gleichsam aus respektvoller Distanz der Autor zwei Tage aus dem Leben eines Jungen zwischen Jugend und Erwachsensein auch schildert, so sehr vermag Bucheli die Empathie des Textes zu spüren, weil es eben jene unangetastete Rätselhaftigkeit ist, die für Bucheli die Situation des Jungen, seine Gefühlswelt, am besten beschreibt. Schwebend erscheint ihm der Text auch, indem der Autor ihn in einem Niemandsland ansiedelt, durch das sich der Held teilnahms- und orientierungslos bewegt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Denn es geht darin ja vielmehr um die Konzentration auf eine partikuläre Perspektive - eine radikal subjektivistische Sachlichkeit, könnte man sagen -, die in ihrer Konsequenz und Geduldigkeit ein Kunststück ist. Der verschleierte Blick, der dadurch entsteht, macht schließlich die Augen, die sehen, selbst zum literarischen Thema.« Marie Schmidt DIE ZEIT 20111110