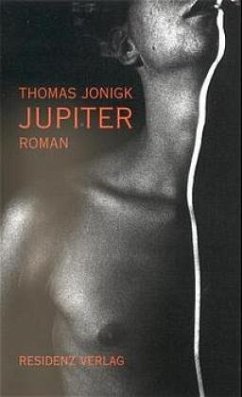"Erregung und Ekel. Dazwischen gibt es nichts."Ein Buch, das verstören und begeistern wird, keines, das den Leser unbeteiligt lässt."Erregung und Ekel. Dazwischen gibt es nichts."Die Erfahrung, von der hier gesprochen wird, findet ihren Niederschlag vor allem auf schäbigen Herrentoiletten. Da aber für den Ich-Erzähler nur zum Opfer wird, wer sich entscheidet, vor seinem Vergewaltiger zu wimmern, besteht er darauf, sich gut zu fühlen. Die Totalverdrängung der erfahrenen psychischen und sexuellen Gewalt führt über das langsame Absterben seines Körpers bis hin zur Persönlichkeitsspaltung. Die Wurzel der Gewalt bleibt im Hintergrund. Der Akzent liegt auf den vom Ich-Erzähler als Kind entwickelten Überlebensstrategien, die nach und nach zur Selbstauslöschung führen. Thomas Jonigk, der sich bislang als Theaterautor einen Namen gemacht hat, legt mit "Jupiter" ein provozierendes Romandebüt vor. Er verzichtet auf Schuldzuweisungen, Mitgefühl und lässt - politisch unkorrekt - die Täter- bzw. Opferrolle ständig kippen.Die souveräne Handhabung literarischer Techniken, die emotionale Bandbreite, die entfaltet wird, und der streckenweise geradezu skandalös heitere Ton lassen die vielen Nuancen der Gewalt nur noch deutlicher hervortreten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Thomas Jonigk liebt Ekel und Panik über jedes Maß
Mit "Nützen und Erfreuen" (prodesse et delectare) umschrieb einst Horaz ein wenig altmodisch die Aufgaben der Dichtkunst. Das müssen schöne Zeiten gewesen sein. Eher auf "Ekel und Panik" läuft die Wirkung eines Romans von der sich heute vorn dünkenden Front hinaus: "Jupiter" von Thomas Jonigk. Er ist weder nützlich noch erfreulich. Wir müssten tief gesunken sein, wenn dieses Buch repräsentativ wäre. Der Autor ist begabt, ein vorzüglicher Stilist; der kernige Frohsinn, mit dem er die scheußlichsten Vorgänge schildert, verrät ohne Frage Talent. Aber wer weder seine Ekel- noch seine Panikdrüsen unnötig zu stimulieren wünscht und es satt hat, sich immer wieder von neuem ziellos provozieren zu lassen, dem sei von der Lektüre dieses Werkes abgeraten.
Denn woran wendet Jonigk sein Talent? An die Geschichte des neunzehnjährigen Martin, der sich auf den ersten vierzig, in einer schmuddeligen Herrentoilette spielenden Seiten erst von dem Barbesitzer Pedro, dann von zwei jungen Türken, dann von Jürgen und, beim Aufwischen der inzwischen aus Sperma, Blut, Urin, Kot und Erbrochenem entstandenen Sauerei, noch einmal von Pedro penetrieren lässt. Martin, blutend und kotzend, bleibt dennoch unbeteiligt wie ein Stein. Er wohnt bei Jürgen. Jürgen dreht mit seiner vierjährigen Tochter sadistische Pornos. Martin steigt zu seinem Vater in die Badewanne und vollzieht dort diverse sexuelle Handlungen, in denen er geübt ist, denn schon als Kind wäre er einmal am Samen des Vaters fast erstickt. Eine schaurige Diskussion erhebt sich: wer daran schuld war, der Vater oder der vierjährige Sohn mit seinem Liebreiz? Die Diskussion bleibt unentschieden, wie denn überhaupt dieser Roman von einer beispiellosen moralischen Kälte ist. Alle handeln wie Automaten. Niemand ist für irgend etwas verantwortlich.
Die einzige halbwegs menschliche Person, ein sympathischer Selbstmordkandidat namens Harald, wird sexuell fast zu Tode gefoltert, zur Strafe dafür, dass ihm nicht danach war, Martin zu penetrieren. Die Folterung ist wie ein verzweifelter Versuch, etwas wie "Seele" zur Äußerung zu zwingen. Erfolglos natürlich und nur die völlige Abwesenheit auch der letzten Reste humaner Gesittung anzeigend. Vorstehendes ist freilich ein Philisterurteil; es ist nicht gehörig in unbedingt avantgardistischen Kreisen, von einem Werk voraussetzungsloser Kunst Gesittung zu erwarten.
Martin hat sich mittlerweile immer öfter aufgespalten in "Martin" und "ich". Dem "Ich" gelingt es schließlich, "Martin" zu töten. Das ändert allerdings nichts und ist kein Ausweg. Denn die Schlusssätze des Buchs münden wieder in die Anfangssätze ein, und alles geht von vorne los.
Der Roman steht vor uns als geschlossener alternativloser Kreislauf. Seine durch nichts zu beeindruckende Sprache kennt keine Instanz, vor der sich das dumpfe Dasein der geschilderten Figuren rechtfertigen müsste. Die Wörter sind Teil der Entfremdung. Was gesprochen wird, erklärt nichts. Die "Kommunikation" ist eher ein Hindernis. Hier begreift keiner sich selbst. Die Sprache stellt nur ramponierte Kulissen bereit, die von Szene zu Szene anderen Zwecken dienen. Ihre Hilflosigkeit wird immer wieder in paradoxen Sentenzen vorgeführt: "Ich bin sprachlos vor Glück und sage das allen." Worauf sprachloses Unglück folgt. Alles Sprechen ist "daneben", die Sprache ist gesondert vom Körper, den sie auch "meinen Fremdkörper" nennt. Doch findet auch dieser Körper keine angemessenen Ausdrucksformen. Er ist genauso hilflos. Es gibt kein feines Spiel der Gesten, und man kann an den Gesten auch nichts ablesen; sie sind auf groteske Weise verkehrt wie die Wörter. Die Übermacht der Sexualakte schlägt alle anderen Äußerungsformen tot. Zwanghaft schieben sie sich an die Stelle der Menschlichkeit.
Jonigk versteht etwas von Schizophrenie. Der psychiatrische Casus ist zu beschreiben als eine Persönlichkeitsspaltung, die von der traumatischen Vergewaltigung durch den Vater ausgelöst wurde. Könnte man das Buch klinisch lesen, es wäre eine Art Trost; es böte eine auf Therapie und Heilung gerichtete Optik. Aber der Autor gestattet uns kein solches Schlupfloch. So müssen wir annehmen, dass er die Welt so sieht, wie er sie malt, dass zumindest seine Phantasie von Gestalten der geschilderten Art bevölkert wird (womit er sich ohne Stolz abfindet), dass auf Messers Schneide zwischen Pornographie und Literatur zu tanzen ihm Genuss bereitet, dass er jedenfalls ein hochdekadenter Manierist sein muss, dessen letzte verbliebene Freude es ist, verwüstete Seelen nicht zu heilen, sondern literarisch gekonnt zur Schau zu stellen.
HERMANN KURZKE
Thomas Jonigk: "Jupiter". Roman. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1999. 149 S., geb., 36,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main