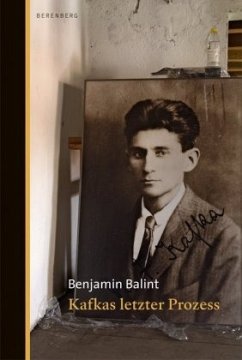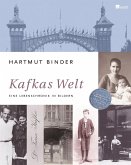Der berühmteste Koffer der Literaturgeschichte hätte es beinahe nicht geschafft. Max Brod hatte ihn bei sich, als er 1939 mit dem letzten Zug von Prag nach Palästina floh. Im Koffer: Manuskripte, Notate, Kritzeleien von Brods Freund Franz Kafka. So romanhaft, wie diese Geschichte beginnt, geht sie Jahrzehnte später auch weiter, und zwar als veritabler Gerichtskrimi, der erst 2016 abgeschlossen wurde. Vordergründig wurde über den Nachlass Max Brods entschieden. Schnell aber wurde klar, dass hier ganz andere Dinge verhandelt wurden. War Kafka vor allem ein jüdischer Autor? Wo ist sein Erbe richtig aufgehoben? In Israel? Oder in jenem Land, in dessen Namen Kafkas Familie einst ausgelöscht wurde?Benjamin Balint erzählt diese filmreife Geschichte, die nicht nur zeigt, weshalb die Frage, welcher Literaturnation Kafka zuzurechnen sei, zum Glück nie entschieden werden kann.

Der Schriftsteller und Journalist Benjamin Balint hat die abenteuerliche Geschichte von Franz Kafkas Nachlass geschrieben. Besonders interessant ist sie in der Frage, wie man in Israel zu diesem Autor steht.
Mit dem allerletzten Zug schaffte es der Schriftsteller Max Brod, im März 1939 aus Prag und der bereits von der Wehrmacht besetzten Tschechoslowakei herauszukommen. Sein wertvollstes, ängstlich im Auge behaltenes Gepäck war ein Koffer, in dem sich Manuskripte, Briefe, Notizen und Tagebücher seines Freundes Franz Kafka befanden. Der Inhalt dieses Koffers wurde später zum Gegenstand eines jahrzehntelangen Rechtsstreits, der Kafkas "Prozess"-Roman (dessen Manuskript ebenfalls im Koffer war) immer ähnlicher zu werden drohte.
Der amerikanische Schriftsteller und Journalist Benjamin Balint hat nun ein fabelhaftes Buch geschrieben, in dem Literaturgeschichte, Justizreportage, Geschichte und Politik eine brisante Mischung eingehen. Schlüsselfiguren des Nachlass-Romans sind Ester Hoffe und ihre Tochter Eva. Ester Hoffe trat 1942 in Max Brods Leben, als der produktive Netzwerker an einem Tiefpunkt war. Er fühlte sich fremd im Exil in Tel Aviv; Europa versank im Inferno von Weltkrieg und Holocaust, seine Ehefrau Elsa war gerade gestorben, und seine Geliebte hatte ihn verlassen. Die neue Freundschaft mit den Hoffes war ein Lichtblick; Ester Hoffe wurde für die letzten 25 Jahre seines Lebens seine wichtigste Mitarbeiterin. Schon 1952 vermachte er ihr die Kafka-Manuskripte mit sofortiger Wirkung als Schenkung, woraus klar hervorgeht, dass sie nicht zu seinem Nachlass gehörten und von den Bestimmungen seines später verfassten Testaments eigentlich nicht betroffen sind. 1961 bestimmte Brod, Ester Hoffe solle dafür sorgen, dass sein Nachlass irgendwann "der Universität Jerusalem oder der Stadtbücherei Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland" zur Verfügung gestellt werde.
Bereits 1973 klagte der Staat Israel zum ersten Mal gegen Ester Hoffe auf Herausgabe der Kafka-Manuskripte - man fürchtete, sie könne sie ins Ausland verkaufen (tatsächlich wurde das "Prozess"-Manuskript an das Literaturarchiv Marbach versteigert). Nach dem Tod von Ester Hoffe strengte die israelische Nationalbibliothek 2009 einen Prozess gegen deren Tochter und Erbin Eva Hoffe an. Kaum zu glauben: Die Tel Aviver Richterin begründete die Wiederaufnahme des Verfahrens mit Zitaten aus Kafkas "Prozess" über den Unterschied zwischen "wirklicher und scheinbarer Freisprechung". Eva Hoffe fühlte sich bald selbst wie eine Figur von Kafka, verfolgt von einer für sie undurchsichtigen Justiz und der Angst vor Enterbung. Da die Hoffes nicht ihrer treuhänderischen Pflicht gegenüber den Nachlass-Manuskripten nachgekommen seien, könne die Schenkung unwirksam werden - so die Drohung. Tatsächlich lagerte Brods umfangreicher Nachlass immer noch in der Hoffe-Wohnung, in der es vor Katzen und Kakerlaken wimmelte. Zwar waren die bedeutendsten Stücke deponiert in Tresoren in Zürich und Tel Aviv und die Kafka-Manuskripte längst akribisch inventarisiert und kopiert worden, aber dennoch atmeten die Literaturwissenschaftler 2016 auf, als Eva Hoffe zugunsten der israelischen Nationalbibliothek enteignet wurde. Nun war ein verlässlicher Umgang mit den Manuskripten garantiert; sie würden der Forschung zugänglich sein. Eva Hoffe, psychisch schwer mitgenommen von dem Prozess, erkrankte bald darauf an Krebs und starb im vergangenen August.
Interessanter als die juristischen Spitzfindigkeiten sind die großen Themen, die in die Argumentationen und Plädoyers eingingen, um ihnen möglichst viel Gewicht zu verleihen. Dazu gehört der Zionismus. Kafka wurde von den israelischen Anwälten als "Monument der jüdischen Kultur" verstanden. Aber wie "jüdisch" war er als Schriftsteller überhaupt? Balint macht deutlich, dass sein geistiger Haushalt vor allem von deutschen Klassikern bestimmt war, von Goethe, Kleist, Hebbel oder Schopenhauer. Erst in späteren Jahren entwickelte er Interesse an den jüdischen Traditionen, begeisterte sich für das jiddische Theater und lernte Hebräisch. Aber in seinen Werken wird das Judentum nie direkt thematisiert, alles liegt im Belieben der Deuter. Wer will, kann Erfahrungen wie "Fremdheit" als "typisch jüdisch" verstehen, ausschließlich jüdisch sind sie gewiss nicht.
Hochinteressant sind Balints Ausführungen über das Verhältnis Israels zur Kultur der Diaspora. Einerseits argumentierten die Vertreter des Landes gegenüber der an den Manuskripten interessierten deutschen Seite so, als gehörten jüdische Kulturgüter auch aus der Zeit vor der Staatsgründung unbedingt nach Israel - im Zuge der großen "Einsammlung des Zerstreuten" im "Land der Rückkehr". Dieser Beanspruchung Kafkas steht jedoch der starke Impuls zur Überwindung der Diaspora-Kultur gegenüber. Und hier findet sich die Erklärung, warum in Israel nie - wie in Deutschland oder Amerika - ein Kafka-Kult herrschte, warum es dort bis heute keinen Kafka-Preis und keine Kafka-Straße gibt und nicht einmal eine Gesamtausgabe seiner Werke. Balint schreibt: "Kafka verkörpert für die Israelis nicht zuletzt die politische Machtlosigkeit und Passivität, den Pessimismus, der aus eigener Hilflosigkeit erwächst und den die Zionisten entschieden ablehnen." Kafkas Hypochondrie, seine Beschwörung der Nichtankunft, seine Abgründe der Schuld und Selbstverdammung waren genau das, womit die Generation der israelischen Gründer nichts mehr zu tun haben wollte. Tatkraft und Optimismus waren gefragt. Kafka bot weniger eine Lektüre für die Überlebenden des Holocaust als für zerknirschte Deutsche. Insofern habe das Bemühen bundesrepublikanischer Institutionen um Kafka und seine Manuskripte viel damit zu tun, "die eigene schändliche Vergangenheit zu überwinden", wie Balint schreibt. Allerdings trat das Literaturarchiv Marbach im Prozess als Sachwalter universalistischer Interessen auf, gegen den zionistischen Partikularismus der Israelis. Auf die Behauptung, dass die Manuskripte in Deutschland besser aufgehoben seien, reagierte ein jüdischer Gelehrter indes gereizt: "Es heißt, die Deutschen würden sich gut darum kümmern. Die Deutschen haben sich aber im Lauf der Geschichte nicht sonderlich gut um Kafkas Sachen gekümmert. Sie haben sich nicht gut um seine Schwestern gekümmert" - die in der Schoa umkamen. Hält man sich die israelische Kafka-Aversion vor Augen, stellt sich dennoch die Frage, warum sich die Nationalbibliothek so hartnäckig um die Kafka-Manuskripte bemühte. Offenbar ging es hier vor allem um das Prestige - mit Kafka lässt sich das internationale Ansehen verbessern.
Balint gibt den Stimmen der Interessenvertreter Raum und bleibt dabei möglichst neutral. Souverän ist der Aufbau des Buches. Die Kapitel über die Nachlass-Prozesse wechseln mit historisch weit ausholenden Exkursen über die vielen Themen und Subtexte, die von den Verfahren berührt wurden. Erfreulich, dass Balint nicht in den Chor der Brod-Verächter einstimmt. Sein Buch ist auch eine Hommage auf eine wunderbare Freundschaft. Max Brod, damals selbst einer der erfolgreichsten und produktivsten Prager Autoren, war sofort von der Genialität Kafkas überzeugt und sammelte jeden Zettel von seiner Hand. Welches Glück es war, dass Kafka an diesen Fürsprecher geraten war, zeigen gerade die Jahre zwischen Tod und Weltruhm. Kafka war noch lange kein Selbstläufer. Unermüdlich trug Brod die nachgelassenen Werke den Verlegern an, die offenbar nicht leicht zu überzeugen waren. "Prozess" und "Schloss" musste er deshalb in verschiedenen Verlagen plazieren. Kurt Wolff klagte darüber, dass er von den 1500 Exemplaren der 1926 erschienenen Erstausgabe von "Das Schloss" nur wenige verkauft habe. Erst mit der Kafka-Gesamtausgabe im Schocken-Verlag (ab 1935) bekam Kafka eine größere Leserschaft in Deutschland, bevor die nationalsozialistische Literaturpolitik wiederum einen Riegel vorschob.
Mag sein, dass viele Details dieses Buches den Kafka-Spezialisten bekannt sind - Benjamin Balint kommt das Verdienst zu, aus dem vielfältigen und hochkomplexen Thema eine spannend zu lesende, ausgewogen informierende Darstellung für alle Kafka-Leser gemacht zu haben.
WOLFGANG SCHNEIDER
Benjamin Balint:
"Kafkas letzter Prozess".
Aus dem Englischen von Anne Emmert. Berenberg Verlag, Berlin 2019. 336 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main