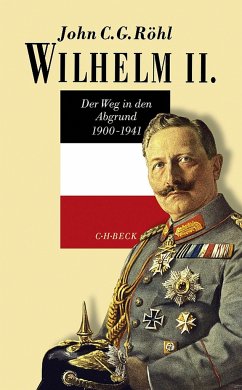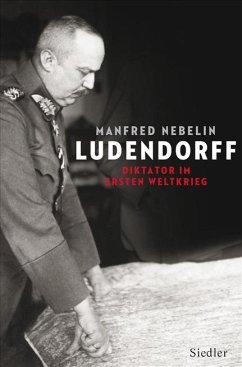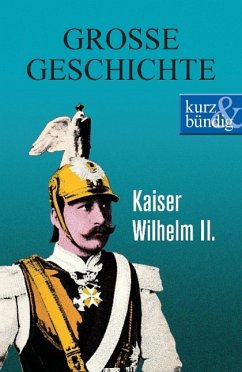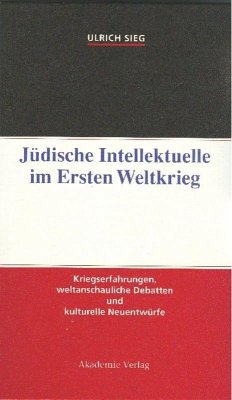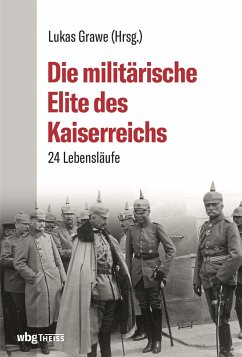Kaiser Wilhelm II. als Oberster Kriegsherr im Ersten Weltkrieg
Quellen aus der militärischen Umgebung des Kaisers 1914-1918
Herausgegeben: Afflerbach, Holger;Mitarbeit: Hildebrand, Klaus
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
118,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Edition "Kaiser Wilhelm II. als Oberster Kriegsherr im Ersten Weltkrieg" stellt der Öffentlichkeit zwei lange verloren geglaubte Quellen zur Verfügung, nämlich das Tagebuch und die Kriegsbriefe des kaiserlichen Generaladjutanten Hans Georg v. Plessen (1841-1929) und die Kriegsbriefe und Tagebuchfragmente des Chefs des Kaiserlichen Militärkabinetts, Moriz Freiherr v. Lyncker (1853-1932). Die Edition umfasst insgesamt 1499 Einzelquellen sowie eine umfangreiche Einleitung in drei großen Teilen. Den Anfang macht ein Abriss über "Wilhelm II. als Obersten Kriegsherrn", der den Forschungsst...
Die Edition "Kaiser Wilhelm II. als Oberster Kriegsherr im Ersten Weltkrieg" stellt der Öffentlichkeit zwei lange verloren geglaubte Quellen zur Verfügung, nämlich das Tagebuch und die Kriegsbriefe des kaiserlichen Generaladjutanten Hans Georg v. Plessen (1841-1929) und die Kriegsbriefe und Tagebuchfragmente des Chefs des Kaiserlichen Militärkabinetts, Moriz Freiherr v. Lyncker (1853-1932). Die Edition umfasst insgesamt 1499 Einzelquellen sowie eine umfangreiche Einleitung in drei großen Teilen. Den Anfang macht ein Abriss über "Wilhelm II. als Obersten Kriegsherrn", der den Forschungsstand darstellt und gleichzeitig aufzeigt, welcher Erkenntnisgewinn aus der Edition zu ziehen ist. Dann folgen biographisch gehaltene Einführungen zu Lyncker und Plessen. Hier liegt der Schwerpunkt darauf zu erläutern, wer diese Generäle waren, welche Funktionen sie ausübten und worin ihre historische Bedeutung lag. Die Einleitung zu Plessen setzt sich vor allem mit den politischen und militärischenEinflussnahmen des Generaladjutanten auseinander. Die zu Lyncker beschäftigt sich mit seinen Entscheidungen als Chef des Militärkabinetts, besonders intensiv mit seinem kritischen Verhältnis zu Wilhelm II. und außerdem mit dem Thema des privaten Verlusts innerhalb der deutschen Führung des Ersten Weltkriegs: Der General verlor in diesem Krieg, den er zu führen half, zwei Söhne. Er wusste, dass er damit sein Lebensglück zerstörte. Die Quelle legt diesen meist vernachlässigten und dabei für eine Mentalitätsgeschichte der deutschen Führung des Ersten Weltkriegs bedeutsamen Aspekt offen.