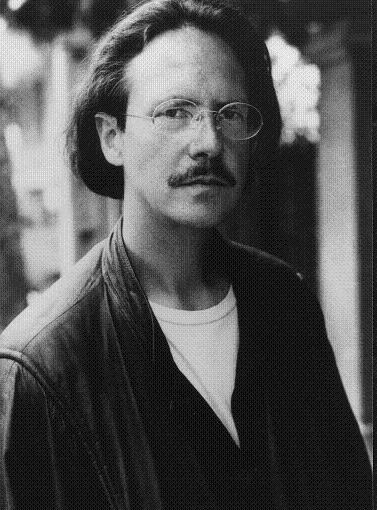In Peter Handkes letztem Roman berichtet Don Juan von seinen Frauenerlebnissen auf einer Weltreise. In Kali, seinem neuen Buch, einer »Vorwintergeschichte«, bricht eineSängerin auf ins Handke-Land: nach Abschluß ihrer Tournee reist sie »in die Gegend gleich nebenan, hinter dem Kindheitsfluß. ... Dort ist der Winter noch Winter. Oder: Es ist eine Auswanderer-Gegend ... Das Einzige, was ich noch weiß: Der Untergrunddort besteht bis in die tiefsten Tiefen aus Salz - Kali. ... Auch im Sommer ein schneeweißer Bergrücken mitten in der Ebene.«An jenem Ort treffen sich die unterschiedlichsten Weltenbewohner, »Überlebende des Dritten Weltkriegs, der rund um uns schon seit langem wütet, unerklärt, wenig sichtbar, aber um so böser«. Die Situation dieser Desperados ist völlig aussichtslos, seit ein Kind verschwunden ist. Reisen ist für die Sängerin gleichbedeutend mitder Neuentdeckung der Welt und der anderen Menschen, Reisen erlaubt aufmerksame und zugleich gelassene Anschauung. Und diese erfordert eine spezifische Erzählweise, in der sich außen und innen in einer noch nie dagewesenen Grammatik verschränken.

Nach all den Kämpfen findet Peter Handke das Glück im Salzberg
Und plötzlich hilft das Wünschen wieder. Oder vielleicht: zum ersten Mal. Am Anfang von Peter Handkes neuem Buch steht die Angst. Die Angst vor der Welt, die Angst vor einer Frau. Doch der Erzähler überwindet sie, gleich zu Beginn, er folgt der Frau hinüber in ein abgeschiedenes Land, wo der Tod, so heißt es, auf sie wartet und ein letztes Mal die Liebe. Es geht auf rasender Fahrt durch ein Untergangsland, eine Untergangswelt, die Zeitungsanpreiser künden vom Ewigen Frieden, doch die so angepriesenen Blätter schreiben wieder nur vom Ewigen Krieg. Die Welt, sie wird regiert vom "schuldlos Schlechten", gegen das das Kämpfen nicht mehr lohnt. Die Frau, eine Sängerin mit magisch schöner Stimme, verabschiedet den Kampf, für immer:
"Immer habe ich eingreifen wollen.
Kämpfen habe ich wollen.
Bekämpfen.
Ausräuchern.
Erlösen, mich und dich, vom Übel.
Wegmusizieren das Unheil, bis morgen,
und warum nicht bis übermorgen?
Immer habe ich einspringen wollen.
Einspringen, das war mein Traumberuf.
Aber inzwischen: nirgends ein mögliches Einspringen mehr.
Welcher Kampf? Und was für ein Kampf?"
Es ist ein weiter Weg, den die Sängerin und mit ihr der Erzähler von der wüsten Einspringerei, dem Kämpfen, Ringen, Brüllen und Verzweifeln zurücklegt, hinüber in eine andere Welt, zum einfachen Schauen, zu einer Zufriedenheit, einem Glück. Hinüber auch und fort vom hohen Ton, den Handke in diesem neuen Buch mitunter in selbst für ihn bislang fast unbekannte Höhen treibt, einen zitternden Predigtton, auf dieser Fahrt, die in den Tod führen sollte und doch ins Leben führt. Am Ende heißt es: "Und nun ausgezittert. Weg von den Dramen. Weg auch von den Liedern. Und auch genug gepredigt - wenn ihr andrerseits dieses oder jenes Predigen hochhalten mögt. Zurück zur Prosa. Ihr seid alle bei mir eingeladen." Und lange schon ist man einer Einladung zur Handke-Prosa nicht mehr so gern gefolgt wie in diesem neuen Buch. In "Kali", einer "Vorwintergeschichte", wie es im Untertitel heißt.
Am Anfang steht die Flucht. Die Flucht der Sängerin nach ihrer Tournee durch den Westen, auf der sie ihre Zuhörer verstörte und mit ihrer Stimme aus dem gewohnten Leben sang, und sei es nur für eine Nacht. Jetzt flieht sie selbst vor sich und vor dem Leben da draußen, zurück ins Kinderland, an einen Ort ganz in der Nähe des Dorfs, in dem sie aufwuchs. Ein Ort, an dem sie niemals war, denn es war ein Unort damals und ist es bis heute geblieben. "Der tote Winkel": "Nicht einmal einen kleinen Abstecher wert war nach übereinstimmender Meinung der tote Winkel hier. Kein Staat war mit ihm zu machen, und das mitten im vereinten Europa. Toter Winkel: aber wie voll Leben habe ich ihn mir von klein auf vorgestellt, allein schon wegen des Namens."
Und jetzt ist es also endlich so weit. Sie fährt hinüber in das leere, ewig ersehnte Land, und der ermutigte Erzähler folgt ihr. Es ist wirklich eine andere Welt dort drüben, sie trägt alle Züge einer handkeschen Gegenwelt. Eigentlich ist es ja nur ein kurzer Weg hinüber. Aber der See, über den man übersetzen muss, erscheint den Fahrenden als endlos weites Meer. Das Boot, das fremde Menschen hinüberfährt und wieder zurück, heißt "Auswanderer". Wer hier hinüberfährt, kehrt lange nicht zurück. Oder auch: nie mehr.
Die Fahrt ist eine Liebesfahrt von Anfang an. Die Sängerin sagt zu Beginn: "Ich gehöre niemandem. So steht es geschrieben. Aber einer gehört mir. Wird mir gehören. Einer. Bald schon. Demnächst. So steht es geschrieben. Er weiß es bloß noch nicht. Wehe ihm. Wohl ihm." Ihn sucht sie also, und wie sie ihn schließlich findet, das ist so eine dieser Scharnierstellen im Buch, an denen es zunächst mächtig krächzt und quietscht und die so skurril überzogen sind, dass sie ganz einfach komisch sind. Sie entdeckt den Mann, den sie sucht - im Fernsehen. Er steht auf der Kuppe eines weißen Salzbergs. Er lächelt. Sie lächelt zurück. Und er sagt nur ein einziges Wort: "Kali". Und nun kommt es zu einer so rührenden Verwechslungsszene wie aus dem indischen Mythologenstadl. Sie ist sofort verzaubert, ahnt, dass sie gerufen wird, und er - geht einfach aus dem Bild. Er hatte sich beim Aussprechen des Wortes in Richtung weißem Berg gewandt, sie glaubt, dass er, "wie in Zärtlichkeit fragend", sie zu sich ruft. Dass er bei dieser rührenden Erkennungsszene nun allerdings den Berg aus Kalisalzen in seinem Rücken meinte, sie jedoch, die Sängerin, sich selbst gemeint fühlt, das wird dem Leser erst viel später klar. Oder erst: beim zweiten Lesen. Er ist Bergwerksingenieur in diesem Kaliwerk im toten Winkel. Sie ist eine Art Wiedergängerin der indischen Gottheit Kali, der Untergangsgöttin, eine dunkle Person mit schwarzem Gesicht, die den Tod bringt und Zerstörung und mit der Zerstörung aber auch: das neue Leben.
Aber zunächst wohl doch den Tod. Und das ist jetzt natürlich wirklich Pech für den Bergwerksingenieur, dass er genau in dem Moment das Wort Kali sehnsuchtsvoll ausgesprochen hat, in dem die indische Göttin gerade Fernsehen schaute. "Warum ich? Warum gerade ich?", fragt er später, als ihm langsam klar wird, dass es sich bei der Begegnung mit ihr nicht um ein Liebesabenteuer, sondern eine letzte Begegnung vor dem Tode handeln soll. Da sagt sie nur: "So ist es gedacht. So habe ich es gesehen, auf den ersten Blick."
Und das ist gerade das immer wieder Schöne an diesem neuen Handke-Buch. Dieses Schwanken zwischen Wut und Sehnsucht, Comic und Kitsch, Weltverachtung, Hoffnungslosigkeit und der Hoffnung auf den Weg hinaus. Höhepunkt von alldem ist die Fahrt des neu zusammengefundenen Paares in den Kaliberg hinab. Zunächst eng aneinandergedrängt fahren sie in diese weiße Tiefe ein. Von vornherein fährt die Ahnung mit, dass das Liebespaar die Fahrt ins Erdinnere nicht überleben wird. Sie steigen um, vom Aufzug in den "Chefjeep" hinein, und hier beginnt eine wahnsinnige rasende Fahrt durch den Kaliberg, "hinunter und hinunter", halluzinatorisch, frenetisch auf Winterreifen in ein immer dunkleres Weiß hinein. In einen Kathedralenraum, wo die weißen Bergleute ihr Mittagbrot essen, und dann wieder weiter hinab. Bis die beiden Menschen, in der tiefsten Tiefe, zu einer einzigen Statue aus Salz verschmelzen. Orpheus ist diesmal einfach dageblieben, bei Eurydike, hat sich gleichsam nach sich selbst umgeschaut, um mit ihr zusammen eine gemeinsame Liebes-Salz-Installation zu bilden.
Ja, das ist kitschig und schön und absurd und wahr. Und als die beiden, aus ihrer Salzerstarrung erwacht, zum letzten Sprung ansetzen, "Jetzt!" ausrufen und sich hinabzustürzen scheinen, da ist der Erzähler selbst ganz aufgeregt, ob seine Geschichte nun womöglich ein abruptes, unglückliches Ende nehmen muss: "Ich kann die beiden nicht mehr sehen und schließe die Augen, höre nur noch den ständig auf- und abschwellenden Wind."
Aber bald schon wird er sie wieder reden hören. Sie haben beschlossen, am Leben zu bleiben. Sie hat beschlossen, dem Fluch nicht zu folgen. Das Glück, das Leben hier im toten Winkel kann neu beginnen. "Wird es neu erscheinen, das Leben?", hatte sie sich zu Beginn der Reise gefragt. Und am Ende weiß sie: "Das Leben ist neu erschienen. Die Träume sind zurückgekommen."
Es ist das Buch einer Verwandlung, wie Handke sich schon oft verwandelt hat, es ist das Buch eines Weltabschieds, wie Handke sich schon oft verabschiedet hat. Es ist aber auch das Buch einer skurrilen, neuen Weltentdeckung, wie er sie bislang noch nicht entdeckt hatte. Ein zunächst etwas mühsamer Abschied von einer großen Weltenwut, einem Verfluchen der Welt der Aktualitäten, der Kriege und der Stars, in einen neuen Mut hinein. "Dort leben, wo die Welt ergreifend ist", schreibt er.
Und dort, in jenem toten Winkel, erscheint sie ihm ergreifend genug, schön genug, friedlich genug.
Der Kämpfer Handke zieht sich erschöpft aus der Arena zurück, die mal den Namen "Jugoslawien", mal "Medien", mal "Nato" trug und findet die Verwandlung, abgewandt von der früheren Welt, in diesem wunderlichen, weißen Land. Im Chefjeep unter Tage. Sehr schön. Und sehr, sehr seltsam.
"Es war seltsam; besonders, daß sich das unter dem Himmel abspielte, und dieser Himmel: so groß. Kam das vom Himmel? War das der Blick? Immer hatte ich mir solche Begegnungen gewünscht, und das Wünschen hatte geholfen."
VOLKER WEIDERMANN
Peter Handke: "Kali. Eine Vorwintergeschichte". Suhrkamp 2007, 161 Seiten, 16,80 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Jawohl, dieser Autor gehört zum "Trüppchen der anhaltend interessantesten Größen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur", verkündet Rezensentin Ursula März an die Adresse sämtlicher Zweifler, zu denen sie sich manchmal auch selber zählt. Denn bei diesem Roman handelt es sich ihrer Ansicht nach um ein atemberaubendes Epos und "strukturstarkes, szenisches Konzentrat", in dem Peter Handke mal wieder sein ganzes beeindruckendes Talent "zur sentimentalen Aufladung ontologischer Kindlichkeitsutopien" unter Beweis gestellt hat - ihre "christlichen Erlösungsszenarien" inklusive. Im Zentrum steht den Informationen der Rezensentin zufolge eine Sängerin, die am Ende einer Konzertreise an den Ort ihrer Kindheit reist, an dem sich auch ein Kaliwerk befindet. Besonders kann Handke die Rezensentin mit seinen Cross-over-Manövern begeistern, die von Beschreibungen des "hell leuchtenden Salzpalastes" im Innern des Bergwerks über Biografisches bis zu Uma Thurmans "Kill-Bill-Kämpferin" reiche. Am Ende zieht die Rezensentin den Hut vor diesem Autor und seinem "rätselhaften" Erzähler, der mit seiner "vieldeutigen Erzählordnung" in ihr das Feuer wahren Leseglücks zu entfachen vermochte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH