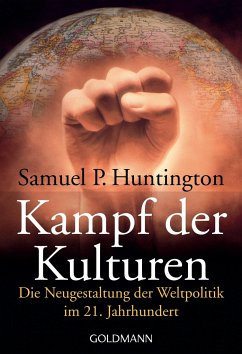Der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington stellt in seinem Buch die Frage nach den weltpolitischen Entwicklungen im 21. Jahrhundert. Statt eines harmonischen Zusammenwachsens in einer zunehmend vernetzten Welt sieht er neue Konflikte globalen Ausmaßes entstehen: Konflikte zwischen den Kulturen. Die Weltpolitik des 21. Jahrhunderts wird nicht mehr von Auseinandersetzungen ideologischer oder wirtschaftlicher Natur bestimmt sein, so Huntingtons These, sondern vom Konflikt zwischen Völkern und Volksgruppen unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeit. Der Faktor Kultur wird folglich in der internationalen Politik massiv an Bedeutung gewinnen. Mit "Clash of Civilisations" hat Huntington eine neue Formel für die künftige Weltordnung formuliert. Provokant, spannend und international heftig diskutiert - ein Muss für jeden politisch interessierten Leser.
Ausstattung: s/w-Abb./Tab./Karten
Ausstattung: s/w-Abb./Tab./Karten
"Es gibt zur Zeit keinen anderen, der so viel Verschiedenes so brillant in einer so originellen Synthese zusammenführen könnte ... Wetzen Sie Ihre intellektuellen Zähne an Huntington. Einen besseren Gegner und Lehrer werden Sie nicht finden." -- Süddeutsche Zeitung
"Ein eminent interessantes Buch ... Viele Phänomene der Gegenwart und wahrscheinlich auch der Zukunft werden auf einleuchtende Weise untersucht und beschrieben." -- Neue Zürcher Zeitung
"Ein eminent interessantes Buch ... Viele Phänomene der Gegenwart und wahrscheinlich auch der Zukunft werden auf einleuchtende Weise untersucht und beschrieben." -- Neue Zürcher Zeitung

Huntingtons "Kampf der Kulturen", wiedergelesen zwanzig Jahre nach dem 11. September
Zur Geschichte des 11. Septembers gehört auch ein Buch, vor allem sein Titel: "The Clash of Civilizations". Die Formel war schon seit 1993 in der Welt, als der Aufsatz des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington in der Zeitschrift Foreign Affairs erschien; 1996 wurde das gleichnamige Buch dann zum Weltbestseller. Doch erst die Bilder der einstürzenden New Yorker Türme ließen die Theorie in vielen westlichen Kommentaren als gültige Beschreibung der nun beginnenden Epoche erscheinen: Was konnte schlagender die Existenz jenes Kampfs der Kulturen beweisen, den Huntington dem Westen nach dem Kalten Krieg vorausgesagt hatte?
Eine vermeintliche Evidenz, die Folgen hatte. Bald zwar versicherten die NATO-Politiker, auch Präsident Bush, dass mit dem "War on Terror" nicht der Islam als solcher gemeint sei, sondern nur der gewalttätige Islamismus. Doch die Vorstellung einander antagonistisch gegenüberstehender Weltkulturen bildete die Folie, vor der das "Wir oder sie"-Ultimatum, mit dem die Bush-Regierung die Welt in Freunde und Schurken einteilte, eine Zeit lang Zustimmung in den westlichen Öffentlichkeiten erhielt. Und wann immer in den folgenden Jahren versucht wurde, zwischen Kultur und Verbrechen, Religion und Ideologie, Traditionen und deren sozioökonomischen Bedingungen zu unterscheiden, lieferte Huntingtons Kulturkampf-Motiv den wenigsten implizit anwesenden Widerpart.
Zwanzig Jahre danach sind es wieder dramatische Bilder, die zu Symbolen für die Lage des Westens werden. Hatten sie 2001 seine Verwundbarkeit auf eigenem Boden bewusst gemacht, zeigen sie 2021 mit dem Einmarsch der Taliban in Kabul die Grenzen seiner globalen Hegemonie auf, all seiner militärischen, ökonomischen und technologischen Überlegenheit zum Trotz. Die große Frage ist, worin genau diese Grenzen bestehen und was daraus folgt. Diesmal ist keine Rede mehr vom "Kampf der Kulturen" als dem Buch der Stunde. Zu gründlich haben die vergangenen Jahrzehnte dessen oft grobschlächtige Argumentation desavouiert. Doch wenn man das Buch nach all den Jahren jetzt wieder liest, ist man überrascht.
Nicht darüber, dass sich Huntingtons Prophezeiung der neun großen Kulturkreise als entscheidenden Akteuren der Weltpolitik nicht erfüllt hat. Schon die ersten Kritiker hatten die essenzialistische Vorstellung als wirklichkeitsfremd zurückgewiesen, Kulturen seien gewissermaßen aus sich selbst heraus wirkende und handelnde Blöcke. Huntington macht zwar selbst darauf aufmerksam, dass sich diese Gebilde gegenseitig beeinflussen und verändern, doch er unternimmt noch nicht einmal den Versuch, die Veränderungen mit den ökonomischen, ideologischen und politischen Faktoren in Beziehung zu setzen, die dabei gleichfalls eine Rolle spielen. Der Orientalismus-Kritiker Edward W. Said urteilte daher kurz nach dem 11. September: "Die These vom 'Kampf der Kulturen' ist ein Gimmick wie 'Der Krieg der Welten', eher geeignet zur Stärkung defensiven Selbststolzes als zum kritischen Verstehen der verwirrenden Interdependenz unserer Zeit."
Überraschend ist beim Wiederlesen etwas anderes: Die polemische Wucht, mit der Huntington damals genau jene Desillusionierung des Westens diagnostizierte, die nach dem Rückzug Amerikas und seiner Verbündeten aus Afghanistan jetzt überall das große Thema ist. Als zentrales Problem identifizierte er "die Diskrepanz zwischen den Bemühungen des Westens, speziell Amerikas, um Beförderung einer universalen westlichen Kultur und seiner schwindenden Fähigkeit dazu". Nach dem 11. September wurde Huntington von vielen als Ideologe der Bush-Kriege wahrgenommen. Doch das trifft nicht zu; das ganze Buch ist durchzogen von einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber westlichen Interventionen in anderen Kulturen, ja gegenüber dem westlichen Universalismus selbst. "Was für den Westen Universalismus ist, ist für den Rest der Welt Imperialismus": Strenger hätte es auch der linke indische Kulturkritiker Pankaj Mishra nicht sagen können.
Als Grund seiner Skepsis benennt Huntington das Fortbestehen der kulturellen Prägungen, die sich in weiten Teilen der Welt der speziellen Kultur des Westens gegenüber sperren, auch wenn sie äußere Formen des Konsums, der Kommunikation oder der Popkultur in sich aufnehmen. Der Glaube an eine weltumspannende "Davos-Kultur" sei eine Illusion, die bloß von den einflussreichen Institutionen, Unternehmen und Individuen aus allen Ländern genährt werde, die an ihr teilnehmen - deren Zahl sei jedoch, wie Huntington etwas kühn schätzt, außerhalb des Westens nicht größer als fünfzig Millionen, ein Prozent der Gesamtbevölkerung.
Aus der Perspektive des Afghanistan-Debakels im Jahr 2021 wirken manche Sätze Huntingtons erstaunlich präzise. "Soll ein zerrissenes Land seine zivilisationale Identität erfolgreich neu definieren, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die politische und wirtschaftliche Elite des Landes diesen Schritt grundsätzlich unterstützen und aufrichtig begrüßen. Zweitens muss die Öffentlichkeit bereit sein, diese Neudefinition ihrer Identität zumindest stillschweigend hinzunehmen. Und drittens müssen die dominierenden Elemente der Wirtszivilisation, in den meisten Fällen also des Westens, bereit sein, den Konvertiten zu akzeptieren." Dies sei, fügt Huntington an, "bis heute nirgends gelungen".
Auch diese Kritik am Universalismus, die einem heute weitverbreiteten Gefühl so unheimlich genau entspricht, hat einen fatalen blinden Fleck. Es wäre absurd zu denken, Menschen aus bestimmten Kulturen seien von sich aus nicht geeignet für Demokratie oder Rechtsstaat; auch innerhalb des Islams wird das nur von fundamentalistischen Splittergruppen vertreten. Es gibt Demokratien in allen Kulturräumen, und in vielen Staaten leben Leute mit ganz unterschiedlicher kultureller Herkunft unter für alle gleich geltenden Regeln zusammen. Das Argument bedarf also einer Differenzierung. Das eigentliche Problem scheint hier nicht in bestimmten politischen Prinzipien, sondern im Absehen von der Kultur zu liegen: Offensichtlich braucht eine Demokratisierung überall Anknüpfungspunkte bei dem, was dort jeweils für gut und heilig gehalten wird, in der durch gesellschaftliche, ökonomische und ideologische Faktoren mitgeprägten kulturellen Konstellation also. Allein die skelettierte Form einer Ordnung, wie sie in westlichen Ländern für selbstverständlich gehalten wird, wirkt nicht aus sich heraus attraktiv.
Die Frage ist, warum dieser schlichte, fast selbstverständliche Umstand so lange wenig bedacht wurde. Nach dem Rückzug aus Afghanistan schimpfen alle auf Regierungen und Geheimdienste, dass sie sich und die Öffentlichkeit so lange über die Wirklichkeit des Landes getäuscht haben. Doch anscheinend hat es auch allzu lange zur Kultur westlicher Gesellschaften selbst gehört, fremde Kulturen als Realität nicht ernst zu nehmen. Vielleicht hat sogar die berechtigte Abwehr eines sich eingrenzenden Kulturalismus, wie Huntington ihn vertritt, dazu beigetragen - so als ob sich alle "Kultur" in deren sozialen, politischen, ökonomischen und ideologischen Begleitumständen auflöse, so als spiele sie selbst in Wirklichkeit gar keine Rolle. Man stellt sich die Welt dann als eine Art Erweiterung des multikulturellen Westens vor, in dem es zwar unterschiedliche Herkünfte und Glaubensüberzeugungen gibt, die die überwiegende Mehrheit aber im wohlverstandenen Eigeninteresse ohne Weiteres in einen demokratisch liberalen Rechtsrahmen integrieren kann. So betrachtet man die Welt nach dem Muster einer internationalen Hotelkette, in der einem die überall gleichen Wiedererkennungszeichen die Illusion verschaffen, überall zu Hause zu sein - hier sind es die Wiedererkennungszeichen eines liberalen Bewusstseins, die man vom Westen aus in Afghanistan ebenso wie in allen anderen Weltgegenden vorfinden kann, ohne ihren jeweils sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund zur Kenntnis nehmen zu müssen.
Nicht der Universalismus hat also versagt, sondern das Verkennen seiner Ermöglichung oder Behinderung durch Kultur. Zu Recht hatte der indische Ökonom Amartya Sen in seiner Entgegnung auf das Kulturkampf-Konzept darauf verwiesen, dass kein Mensch im Gefängnis nur einer kulturellen Identität steckt, dass er im realen Leben vielmehr noch aus vielen anderen Identitäten beruflicher, familiärer oder politischer Art zusammengesetzt ist. Doch zwischen diesem Recht des Einzelnen, sich selbst zu bestimmen, dem Kern des westlichen Individualismus, und dem fortdauernden Anspruch vieler Kulturen, in einem nationalen oder lokalen Rahmen Gemeinschaften zu bilden, herrscht eine Spannung, die weder durch Wunschdenken noch durch militärische Besatzungen schon aus der Welt zu schaffen ist.
Mit seiner Entscheidung, sich aus Afghanistan endgültig zurückzuziehen, will Biden zwanzig Jahre nach dem 11. September dessen Epoche zum Abschluss bringen und eine neue beginnen: Nicht der "War on Terror" soll Amerika und den Westen künftig definieren, sondern die Selbstbehauptung gegenüber autokratischen Systemen, insbesondere China. Ein Schwerpunkt ist dabei die technologische Überlegenheit, die schon Huntington für eine Voraussetzung der Selbstbewahrung hielt. Doch auch hier geht es womöglich vor allem um Kultur: darum, dass der Westen sich nicht selbst verliert. Längst wird der Universalismus, der die westlichen Gesellschaften zusammenhält, durch nationalistische und identitäre Einschließungsversuche auch von innen her unterminiert. In einer abgründigen Bemerkung am Ende seines Buchs stellte Huntington mit Blick auf den Westen infrage, dass ein höherer Modernisierungsgrad schon einen höheren Zivilisationsgrad gewährleiste; jener schwanke vielmehr in der Geschichte der einzelnen Kulturen. Vielleicht ist die eigentliche Pointe, die man Huntingtons Buch heute abgewinnen kann, dass der sogenannte Westen erst mal sich selbst als eine Kultur neben anderen erkennen und akzeptieren muss. Mit seiner angemaßten Position über den Kulturen kann er sonst auch seinen universalistischen Ambitionen im Weg stehen. MARK SIEMONS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein eminent interessantes Buch ... Viele Phänomene der Gegenwart und wahrscheinlich auch der Zukunft werden auf einleuchtende Weise untersucht und beschrieben.« Neue Zürcher Zeitung