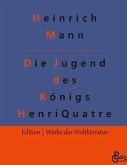Eine satirische Trouvaille aus dem Werk des populären französischen Autors
Wer Alexandre Dumas als Autor historischer Abenteuerepen wie "Die drei Musketiere" kennt, wird von diesem Buch gänzlich überrascht. Die durchtriebene Satire, halb Tiergeschichte, halb Seemannsgarn, steht als Solitär im umfangreichen Werk des viel gelesenen Schriftstellers. Dumas nimmt hier seine eigene Zeit scharf aufs Korn - und gönnt sich dabei selbst einen Auftritt als Romanfigur.
Einer mildtätigen Anwandlung folgend, rettet er, "der Verfasser", in einem Pariser Delikatessengeschäft eine Schildkröte vor ihrem sicheren Ende als Suppeneinlage. Doch bereits anderntags ist er des Tieres und seiner unappetitlichen Essgewohnheiten gründlich überdrüssig. Kurzerhand macht er es seinem Freund, dem Maler Decamps, zum Geschenk, dessen Atelier bereits einer kleinen Menagerie gleicht. Die meisten der anderen Tiere haben einen weit längeren Weg hinter sich als der Neuzugang: Kapitän Pamphile, einer der illustren Bekannten des Malers, hat sie von seinen abenteuerlichen Seereisen mitgebracht. Von diesen Reisen wird erzählt, wann immer Decamps seinen bunten Freundeskreis um sich sammelt. So erfährt man nicht nur, wie die Tiere in Pamphiles Hände gerieten, sondern auch, was der geschäftstüchtige Kapitän unterwegs sonst an skrupellosen "Heldentaten" vollbracht hat.
Dumas' Kunstgriff besteht darin, die haarsträubenden Episoden sämtlich im Ton ungerührter Selbstverständlichkeit zu erzählen, als handle es sich bei Pamphiles merkantilen Schurkenstücken um Geniestreiche an Mut und Geschicklichkeit. Aus dieser Doppelbödigkeit, den scheinbar drollig erzählten, doch alles andere als harmlosen Tier- und Seegeschichten, gewinnt der Roman seine einzigartige, bitterböse Komik.
Wer Alexandre Dumas als Autor historischer Abenteuerepen wie "Die drei Musketiere" kennt, wird von diesem Buch gänzlich überrascht. Die durchtriebene Satire, halb Tiergeschichte, halb Seemannsgarn, steht als Solitär im umfangreichen Werk des viel gelesenen Schriftstellers. Dumas nimmt hier seine eigene Zeit scharf aufs Korn - und gönnt sich dabei selbst einen Auftritt als Romanfigur.
Einer mildtätigen Anwandlung folgend, rettet er, "der Verfasser", in einem Pariser Delikatessengeschäft eine Schildkröte vor ihrem sicheren Ende als Suppeneinlage. Doch bereits anderntags ist er des Tieres und seiner unappetitlichen Essgewohnheiten gründlich überdrüssig. Kurzerhand macht er es seinem Freund, dem Maler Decamps, zum Geschenk, dessen Atelier bereits einer kleinen Menagerie gleicht. Die meisten der anderen Tiere haben einen weit längeren Weg hinter sich als der Neuzugang: Kapitän Pamphile, einer der illustren Bekannten des Malers, hat sie von seinen abenteuerlichen Seereisen mitgebracht. Von diesen Reisen wird erzählt, wann immer Decamps seinen bunten Freundeskreis um sich sammelt. So erfährt man nicht nur, wie die Tiere in Pamphiles Hände gerieten, sondern auch, was der geschäftstüchtige Kapitän unterwegs sonst an skrupellosen "Heldentaten" vollbracht hat.
Dumas' Kunstgriff besteht darin, die haarsträubenden Episoden sämtlich im Ton ungerührter Selbstverständlichkeit zu erzählen, als handle es sich bei Pamphiles merkantilen Schurkenstücken um Geniestreiche an Mut und Geschicklichkeit. Aus dieser Doppelbödigkeit, den scheinbar drollig erzählten, doch alles andere als harmlosen Tier- und Seegeschichten, gewinnt der Roman seine einzigartige, bitterböse Komik.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Bestens amüsiert hat sich Rolf-Bernhard Essig bei der Lektüre von Alexandre Dumas' Roman "Kapitän Pamphile", der nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Er bewundert das gewandte Spiel mit literarischen Anleihen und Bezugnahmen, die Parodie von Coopers Indianerbüchern, La Fontaines Fabeln, Piratenromanen oder auch dem Werk Voltaires. Dabei pflegt der Autor zur Freude des Rezensenten einen "souverän ironischen Stil". Auch das hohe Tempo, die überraschenden Wendungen, die satirischen Einlagen, der wilde Mix aus "naturromantischen Passagen" und "märchenhaftem Grauen" haben es ihm angetan. Dabei scheint ihm das Werk nur prima facie "harmlose Unterhaltung". So lasse die ironisch-gelassene Haltung des Erzählers Grausames und Widerliches erst recht zur Wirkung kommen. Überhaupt konstatiert Essig die "schwarze Grundierung" der bunten Geschichten, die ihre Farben besonders schillern lasse. Schließlich findet er in dem Roman auch das überaus klare Porträt des Europäers des 19. Jahrhunderts als eines Typus, der die Welt als einen "riesigen Feinkostladen" betrachte. Mit Lob bedenkt er auch Jörg Trobitius, der den Roman "gewitzt und sensibel" ins Deutsche übertragen habe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Aus dieser Doppelbödigkeit, den scheinbar unbeschwert dargebotenen, doch alles andere als harmlosen Tier- und Seegeschichten gewinnt der Roman seine einzigartige bitterböse Komik." Passauer Neue Presse