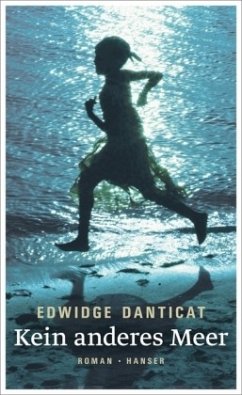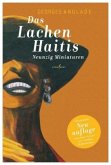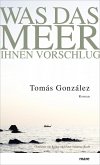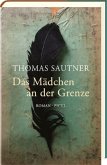Am Morgen hatte sie noch wie jedes Jahr mit ihrem Vater Nozias das Grab der Mutter besucht. Jetzt ist die siebenjährige Claire spurlos verschwunden, am Strand von Ville Rose auf Haiti. Nozias, der Fischer, träumte von einer besseren Zukunft für seine Tochter, frei von Armut und Gewalt. Sie sollte ihr Heimatdorf verlassen, von einer reichen Tuchhändlerin adoptiert werden. Ist Claire deshalb geflohen? Die haitianisch-amerikanische Autorin Danticat erzählt märchenhaft und doch realistisch von Ville Rose, ein Ort, wo Bäume in den Himmel fliegen und Frösche in der Hitze explodieren, und einem Mädchen, das sich nach Familie und Geborgenheit sehnt.

Haiti im Hier und Heute, ohne Ausflüchte und Schönfärberei: Edwidge Danticat vermeidet in ihrem großartigen Roman postkoloniale Klischees
Vor zehn, zwölf Jahren in Haiti klopften frühmorgens Kinder an meine Tür und führten mich zu einem Toten, der im Lauf der Nacht mit Kopfschüssen liquidiert und aus einem fahrenden Auto geworfen worden war. "Wie schrecklich", sagte ich mit Blick auf die Schuhe des Ermordeten, die stets als Erstes gestohlen wurden, aber die Straßenkinder waren nicht einverstanden. "Non Monsieur", flüsterten sie: "C'est la démocratie!"
Das war kein schwarzer Humor, sondern Ausdruck der Erfahrung, dass das Töten sich "demokratisiert" hatte seit dem Sturz der Diktatur, in der Folter und Mord aufs Konto der Geheimpolizei gingen: Danach waren Menschenleben noch weniger wert als zuvor. Manchmal tut Kindermund die Wahrheit kund, und die drastische Anekdote macht verständlich, warum im Hinterhof der Vereinigten Staaten, anderthalb Flugstunden von Miami entfernt, ein mühsam gebändigtes Chaos herrscht, das tragische und zugleich tragikomische Züge trägt: Nicht umsonst nannte Graham Greene seinen Haiti-Roman, dessen Verfilmung mit Richard Burton und Elisabeth Taylor nach wie vor sehenswert ist, "The Comedians".
Diese Vorbemerkung ist unerlässlich zum Verständnis von Edwidge Danticats Roman "Kein anderes Meer", der im Original "Claire of the Sea Light" heißt: ein großartiges Buch, von Kathrin Razum kongenial übersetzt, das Lesern, die Haiti nicht kennen, Empathie und Geduld abverlangt, obwohl oder weil die auf den ersten Blick abwegig anmutende Geschichte der Realität abgelauscht ist. Ich kenne keinen zeitgenössischen Roman, der das "unlebbar" gewordene Leben der Haitianer so hautnah nachvollzieht, und es ist bezeichnend, dass die aus Haiti stammende, in Amerika ansässige Autorin ihre Texte auf Englisch schreibt - ohne diese Distanz könnte sie den täglichen Überlebenskampf nicht so eindringlich schildern.
Worum geht es? Die Titelheldin des Buches trägt den sprechenden Namen Claire Limyè Lanmè, kreolisch für Licht und Meer: Ihr Leben wird rückwärts erzählt, vom sechsten Geburtstag, an dem sie spurlos verschwindet, bis zur Geburt, bei der die Mutter starb, und von dort bis zum Wiederauftauchen des Mädchens - die überraschende Wendung am Schluss darf hier nicht verraten werden. Der Vater des Kindes, Nozias Faustin, ist ein Fischer, der von der Hand in den Mund lebt, weil Haitis Küstengewässer leer gefischt und durch Giftmüll verseucht worden sind.
In seiner Not beschließt er, Claire Limyè zu einer Stoffhändlerin in Pflege zu geben, die ihre Tochter bei einem Unfall verlor. "Restavek" - so nennt man die Kinder, die als Arbeitskräfte ausgebeutet und/oder sexuell missbraucht werden: eine moderne Form der Sklaverei, die doppelt empörend ist, weil Haiti seine staatliche Existenz einer Sklavenrevolte verdankt und die Sklaverei schon 1804 offiziell abgeschafft hat. Als die Stoffhändlerin im weißen Mercedes vor der Fischerhütte parkt, um das Kind abzuholen, entflieht Claire Limyè ins Dunkel der Nacht. Anwohner schwärmen aus, um sie zu suchen, während Fischer am Strand ein Feuer entfachen zum Gedenken an einen der Ihren, dessen Boot eine Monsterwelle in die Tiefe riss. Hier ist nicht der Ort, die Peripetien der Handlung nachzuerzählen, die wie Schnitzlers "Reigen" wechselnde Paare in den Kreislauf von Geburt und Tod hineinzieht, bis der Erzählkreis sich schließt. Der Rundtanz, den Claire Limyè mit ihren Freundinnen am Strand vollführt, kreolisch "wonn", ist ein Symbol dafür. Schauplatz der Geschichte ist Ville Rose, ein Küstenort südlich von Port-au-Prince, dessen idyllischer Name täuscht: Dahinter ist unschwer die in einer seismischen Bruchzone liegende Stadt Léogane zu erkennen, deren Bewohner das Erdbeben vom Januar 2010 in den Ruinen ihrer Häuser begrub.
Aber nicht von dieser Megakatastrophe ist hier die Rede, sondern von der Erosion moralischer Werte und vom Zerfall sozialen Zusammenhalts, der sich subkutan, unter der Oberfläche, vollzieht: "Trotzdem konnte sich Bernard des Gefühls nicht erwehren, dass sie eines Tages alle erschossen würden ... Eines Tages würde irgendjemand, der wütend und mächtig und irr war - ein Polizeichef oder ein Bandenführer oder ein Staatsoberhaupt -, auf den Gedanken kommen, dass sie und alle, die in ihrer Nähe und auf ihre Weise lebten, tot eigentlich besser dran wären."
Dieses Fazit klingt durchaus realistisch im Armenhaus der westlichen Welt, wo der Mindestlohn drei Dollar und die Arbeitslosigkeit sechzig Prozent betragen. Umso höher ist zu bewerten, dass Edwidge Danticat keinen Elendsroman vorlegt, der ans schlechte Gewissen westlicher Leser appelliert oder, noch schlimmer, die Misere romantisch verklärt. Kunst ist das Gegenteil von gut gemeint, und die Stärke des Buches liegt darin, dass und wie die Autorin postkoloniale Klischees vermeidet und den Menschen Haitis ihre Individualität und verlorene Würde zurückgibt. Diskret und scheinbar unangestrengt gelingt es ihr, sich in die Psyche einer Sechsjährigen so glaubhaft einzufühlen wie in den armen Fischer und die reiche Stoffhändlerin, in den Bürgermeister, der von Beruf Leichenwäscher ist, und in den Sohn aus gutem Haus, der, um seinem Vater zu beweisen, dass er nicht schwul ist, ein Dienstmädchen vergewaltigt.
Nicht Schnitzlers "Reigen", sondern Thornton Wilders einst vielgespieltes Stück "Our Town" ("Unsere kleine Stadt") ist das dramaturgische Modell des Textes, der, poetisch verdichtet, existentielle Erfahrungen Revue passieren lässt - von erster Liebe und Heirat bis zur Rückkehr aus dem Totenreich. "Jene Nacht im Hausmädchenzimmer mit Max Junior auf ihr war für Flore genau dieser Moment gewesen. Darüber hinaus, hatte Louise erklärt, müsse man Namen nennen, und in diesem speziellen Fall sollten die Namen so oft wie möglich wiederholt werden." Die Wahrheit ist konkret, das Böse hat Hausnummer und Adresse, und indem er Haiti genau in den Blick nimmt, hier und heute, ohne Ausflüchte und Schönfärberei, wird der Roman, über den speziellen Fall hinaus, zur Parabel der Condition humaine: "Wer man ist, zeigt sich darin, wen man liebt, hatte sie ihm erklärt ... Aber denk daran, die Liebe ist wie Petroleum. Je mehr man davon hat, desto stärker brennt man."
Das Buch ist adäquat übersetzt; umso schmerzlicher ist das Fehlen eines Nachworts oder Glossars als Ariadnefaden durchs Labyrinth kreolischer Sprache und Kultur.
HANS CHRISTOPH BUCH.
Edwidge Danticat: "Kein anderes Meer". Roman.
Aus dem Englischen von Kathrin Razum. Hanser Verlag, München 2015. 255 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Geradezu "mythopoetisch" erscheint dem Rezensenten Christoph Bartmann dieser Roman Edwige Danticats über Leben und Leute in einem fiktiven haitianischen Küstenort. Allein wie die auf Haiti geborene Autorin von den fast biblischen Naturkatastrophen schreibt, etwa von in der Hitze explodierenden Fröschen, verschlägt dem Kritiker fast den Atem. Dennoch wirkt die von Danticat in acht brillant ineinander verwobenen Erzählungen geschilderte Welt auf den Rezensenten "schrecklich schön". Frauen und Orte tragen etwa Blumennamen, berichtet Bartmann, der Traum und Realität während der Lektüre kaum auseinander halten kann. Gelegentlich muss der Kritiker an P.T. Andersons Film "Magnolia" denken, vor allem aber bewundert er die lyrisch-blumige Erzählkunst der Autorin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Eine uneingeschränkt empfehlenswerte Lektüre." Klaus Küpper, lateinamerikaarchiv.de
Danticat verwendet "eine klare, bilderreiche Prosa, die scheinbar mühelos zwischen den Jahren hin und her springt und in einer klug konstruierten Dramaturgie immer neue Facetten und Zusammenhänge zutage fördert." Irene Binal, Neue Zürcher Zeitung, 20.01.16
"Edwidge Danticats wild fantasierende Erzählkunst führt eine harte Welt vor Augen. ... Danticat ist die Chronistin oder vielleicht auch die Mythopoetin dieser schrecklich-schönen Welt." Christoph Bartmann, Süddeutsche Zeitung, 01.12.15
"Ein sehr poetisches Buch, das an keiner Stelle die Schönheit der Tropen verklärt und immer wieder die Brutalität der haitianischen Wirklichkeit zeigt." Brigitte Wir, 2/15
"Ein großartiges Buch, von Kathrin Razum kongenial übersetzt, das Lesern, die Haiti nicht kennen, Empathie und Geduld abverlangt, obwohl oder weil die auf den ersten Blick abwegig anmutende Geschichte der Realität abgelauscht ist." Christoph Buch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.15
"Danticats Sprache ist leise und von poetischer Melancholie. Gewalt, Tod, Verlust schildert die Autorin so ruhig und unaufgeregt, dass die menschliche Tragik umso heftiger zuschlägt. ... Ein ungemein gelungener Roman." Marie-Sophie Adeosso, Frankfurter Rundschau, 13.10.15
Danticat verwendet "eine klare, bilderreiche Prosa, die scheinbar mühelos zwischen den Jahren hin und her springt und in einer klug konstruierten Dramaturgie immer neue Facetten und Zusammenhänge zutage fördert." Irene Binal, Neue Zürcher Zeitung, 20.01.16
"Edwidge Danticats wild fantasierende Erzählkunst führt eine harte Welt vor Augen. ... Danticat ist die Chronistin oder vielleicht auch die Mythopoetin dieser schrecklich-schönen Welt." Christoph Bartmann, Süddeutsche Zeitung, 01.12.15
"Ein sehr poetisches Buch, das an keiner Stelle die Schönheit der Tropen verklärt und immer wieder die Brutalität der haitianischen Wirklichkeit zeigt." Brigitte Wir, 2/15
"Ein großartiges Buch, von Kathrin Razum kongenial übersetzt, das Lesern, die Haiti nicht kennen, Empathie und Geduld abverlangt, obwohl oder weil die auf den ersten Blick abwegig anmutende Geschichte der Realität abgelauscht ist." Christoph Buch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.15
"Danticats Sprache ist leise und von poetischer Melancholie. Gewalt, Tod, Verlust schildert die Autorin so ruhig und unaufgeregt, dass die menschliche Tragik umso heftiger zuschlägt. ... Ein ungemein gelungener Roman." Marie-Sophie Adeosso, Frankfurter Rundschau, 13.10.15