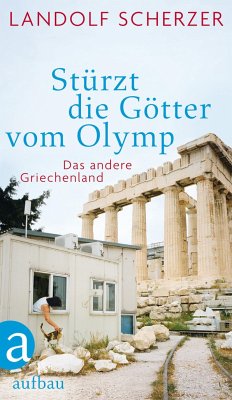Kein Grund zur Selbstreinigung
Die Titanic-Kolumnen
Herausgegeben: Kapp, Christoph; Thein, Helen;Mitarbeit: Gärtner, Stefan
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Walter Boehlich (1921-2006) arbeitete als einer der strengsten Literaturkritiker seiner Generation u .a. für Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung, Deutsche Volkszeitung und Konkret, kannte den Kulturbetrieb wie nur wenige andere und war über zehn Jahre als Cheflektor beim Suhrkamp Verlag tätig. Er war Essayist, gab Sigmund Freud heraus, gründete den Verlag der Autoren, publizierte über Thomas Mann und Marcel Proust und übersetzte aus dem Französischen, Spanischen und Dänischen u.a. Marguerite Duras, Søren Kierkegaard, Virginia Woolf.Von November 1979 bis Januar 2001 schrieb er monatl...
Walter Boehlich (1921-2006) arbeitete als einer der strengsten Literaturkritiker seiner Generation u .a. für Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung, Deutsche Volkszeitung und Konkret, kannte den Kulturbetrieb wie nur wenige andere und war über zehn Jahre als Cheflektor beim Suhrkamp Verlag tätig. Er war Essayist, gab Sigmund Freud heraus, gründete den Verlag der Autoren, publizierte über Thomas Mann und Marcel Proust und übersetzte aus dem Französischen, Spanischen und Dänischen u.a. Marguerite Duras, Søren Kierkegaard, Virginia Woolf.Von November 1979 bis Januar 2001 schrieb er monatlich eine politische Kolumne für das Satiremagazin Titanic und damit auch eine Geschichte der alten und der neuen Bundesrepublik. Das war und ist politische Aufklärung im besten Sinne: links, radikal, demokratisch. Im Nachruf der Titanic wurde Walter Boehlich als die »schillerndste, mysteriöseste und gleichzeitig ehrfurchtgebietendste Persönlichkeit der Titanic« beschrieben. Nun erscheint eine Auswahl seiner Titanic-Kolumnen erstmals als Buch.