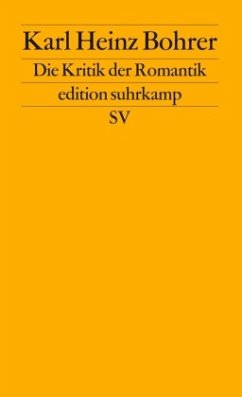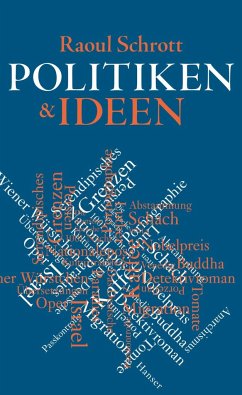Kein Wille zur Macht

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Provozierende Thesen zur deutschen Mentalität und das Land im europäischen Kräftespiel der letzten 150 Jahre - eine eindringliche Lektion in Sachen geistiger Unabhängigkeit Karl Heinz Bohrers Wortmeldungen zur Politik zielen stets aufs Ganze. Am Tagesgeschäft interessiert ihn besonders, wie es verleugnete, verdrängte und vergessene Konflikte sichtbar macht. Deutschlands Weigerung, eine angemessene Rolle in der Welt zu spielen, der verklemmte Umgang mit der preußischen Vergangenheit, die Erinnerung an die beiden Weltkriege: An solchen Fragen zeigt sich, dass ein fundierter politischer St...
Provozierende Thesen zur deutschen Mentalität und das Land im europäischen Kräftespiel der letzten 150 Jahre - eine eindringliche Lektion in Sachen geistiger Unabhängigkeit Karl Heinz Bohrers Wortmeldungen zur Politik zielen stets aufs Ganze. Am Tagesgeschäft interessiert ihn besonders, wie es verleugnete, verdrängte und vergessene Konflikte sichtbar macht. Deutschlands Weigerung, eine angemessene Rolle in der Welt zu spielen, der verklemmte Umgang mit der preußischen Vergangenheit, die Erinnerung an die beiden Weltkriege: An solchen Fragen zeigt sich, dass ein fundierter politischer Standpunkt auf die historische Perspektive, das philosophische Argument und die literarische Erinnerung nicht verzichten kann. In sechs Essays analysiert Bohrer das europäische Kräftespiel der letzten 150 Jahre - eine eindringliche Lektion in Sachen geistiger Unabhängigkeit.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.