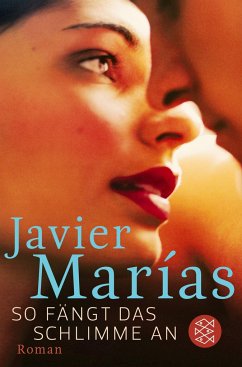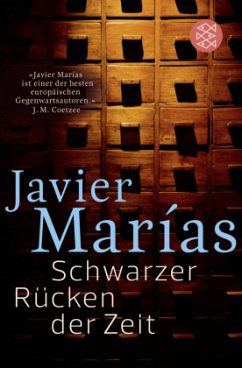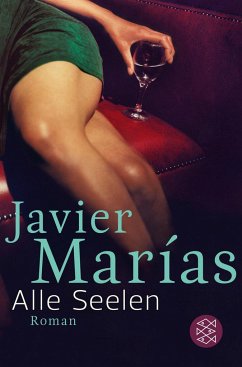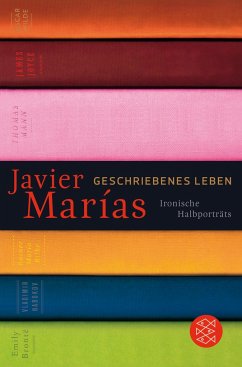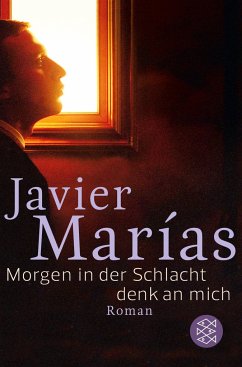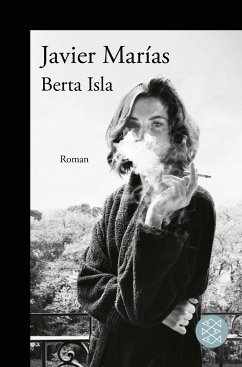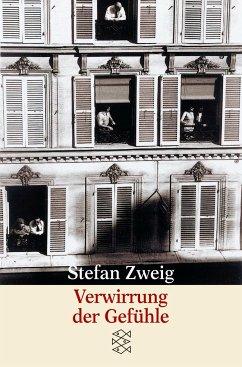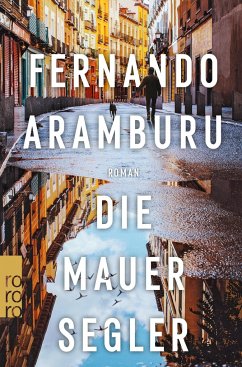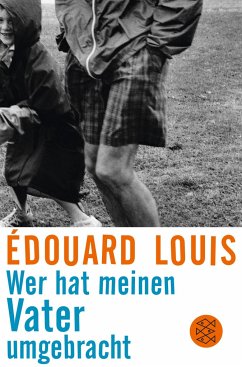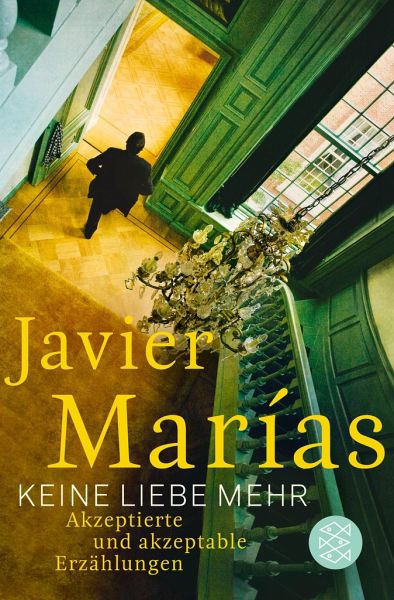
Keine Liebe mehr
Akzeptierte und akzeptable Erzählungen
Übersetzung: Lange, Susanne; Wehr, Elke; Zuniga, Renata
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
22,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein von einer afrikanischen Lanze durchbohrtes Paar, eine Pornoschauspielerin, ein Butler, der in einem New Yorker Aufzug stecken bleibt - mysteriöse Ärzte, wollüstige Ehefrauen, Bodyguards und Gespenster, das sind die Helden in Javier Marías' Erzählungen, die einem abwechselnd den Atem nehmen, einen in schallendes Lachen ausbrechen oder über die ein oder andere Lebensweisheit nachdenken lassen. Javier Marías ist ein Zauberer, "ein bestrickender, manchmal auch dämonischer Verführer" (Paul Ingendaay, Frankfurter Allgemeine Zeitung). "Keine Liebe mehr" vereint endlich Marías' gesammelt...
Ein von einer afrikanischen Lanze durchbohrtes Paar, eine Pornoschauspielerin, ein Butler, der in einem New Yorker Aufzug stecken bleibt - mysteriöse Ärzte, wollüstige Ehefrauen, Bodyguards und Gespenster, das sind die Helden in Javier Marías' Erzählungen, die einem abwechselnd den Atem nehmen, einen in schallendes Lachen ausbrechen oder über die ein oder andere Lebensweisheit nachdenken lassen. Javier Marías ist ein Zauberer, "ein bestrickender, manchmal auch dämonischer Verführer" (Paul Ingendaay, Frankfurter Allgemeine Zeitung). "Keine Liebe mehr" vereint endlich Marías' gesammelte Erzählungen: der große Erzähler at its best.