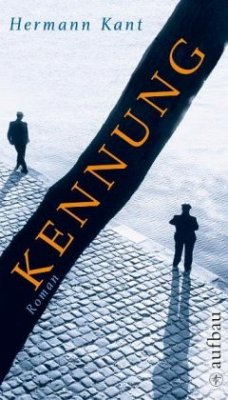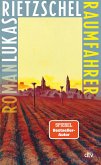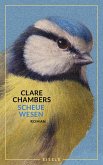"Nichts ist schlimmer, als nicht mehr den Überblick über Freund und Feind zu haben."Hermann Kants brisanter Roman ist ein zur Groteske getriebenes Spiel um Einfluss, Beschränktheit und Arroganz eines Machtapparats. Das Beispiel der jungen DDR dient als Folie für die Ambivalenz des Verhältnisses zwischen Machthabern und Künstlern.Linus Cord gilt als "aufstrebender Kritiker", sein Ehrgeiz ist es jedoch, ein "beträchtlicher Essayist" zu werden. Der Aufsatz, an dem er jetzt, im Frühjahr 1961, schreibt, soll ihm die erhoffte Anerkennung bringen.Eines Vormittags steht einer der auffällig unauffälligen Herren mit der Klappkarte vor seiner Tür. Ohne Umschweife erkundigt er sich, ob Cord noch die Nummer seiner Wehrmachts-Erkennungsmarke wisse. Da Cord verneint, fragt er, ob er bereit wäre, sich bei der Westberliner Auskunftsstelle danach zu erkundigen. Cord lehnt gewunden - immerhin ist er überzeugter Genosse -, aber deutlich ab.Als der ungebetene Besucher gegangen ist, ist Cord mit sich im Reinen. Noch ahnt er nicht, welches Szenarium für ihn vorgesehen ist. Was er von nun an auch tut, es wird ihn hineinziehen in die alltägliche Absurdität eines Macht- und Ränkespiels und zerstören.

Weiß er noch, wovon er redet? Der Schriftsteller Hermann Kant war selbst Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Jetzt hat er einen Roman über die Arbeit der "Firma" geschrieben, der mehr verdunkelt als erhellt.
Gerade erst schilderte uns die Dokumentation "Günter Grass im Visier" aus dem Berliner Christoph Links Verlag, wie der Schriftsteller Grass bei Besuchen in der DDR von Helfern der Staatssicherheit überwacht wurde (F.A.Z. vom 6. März), unter den Wächtern auch der IM "Martin", Grass' Kollege Hermann Kant. Und gleich danach erreicht uns aus dem Berliner Aufbau Verlag ein neuer Roman von Hermann Kant mit dem Titel "Kennung", dessen Thema das Wirken der DDR-Staatssicherheit ist.
Ein toller Zufall! Da haben wir, so will es auf den ersten Blick scheinen, endlich einmal Gelegenheit, von den Kenntnissen eines Insiders zu profitieren. Und das nicht im trockenen Stil der Dokumente in der Birthler-Behörde, sondern, viel interessanter, im Rahmen eines Romangeschehens.
Diese Erwartung wird freilich schnell enttäuscht. Schon nach wenigen Seiten erkennt der Leser, dass der Autor keineswegs den einstigen Überwachungsvampir, gar die eigene Beziehung zu jenem Blutsauger ins Fadenkreuz nimmt, sondern stattdessen eine Art Märchen erzählt. Die Handlung prunkt mit einer Fülle rätselhafter Geschehnisse, deren Deutung lange auf sich warten lässt und uns, wenn sie endlich geliefert wird, ganz unmärchenhaft enttäuscht. Dazu kommt, dass die Hälfte des Buchumfangs genügt hätte, um die Romangeschichte mitzuteilen. Die tatsächlich vorhandenen zweihundertfünfzig Seiten sind eindeutig zu viel und nur deshalb zustande gekommen, weil der Autor Kant es liebt, Gesagtes oft zu wiederholen und Fakten so reichhaltig mit Wortgirlanden zu dekorieren, dass man sie unter dem Schmuck kaum erkennen kann.
Held des Romans ist ein Literaturkritiker namens Linus Cord, der noch keine große Karriere gemacht hat, sie aber machen möchte. Er beabsichtigt, ein "beträchtlicher Essayist" zu werden, und werkelt zu diesem Zweck an einer Arbeit, in der er den Schriftsteller Ambrose Bierce, Zeitgenosse des amerikanischen Bürgerkrieges, und den DDR-Autor Stephan Hermlin kritisch vergleicht. Mit Kant hat Linus Cord nicht viel gemein, ein bisschen aber doch. 1927 geboren, ist er ein Jahr jünger als sein Erfinder, musste wie dieser nach knapp begonnenem Arbeiterleben als halbes Kind in den Zweiten Weltkrieg ziehen und geriet in Gefangenschaft.
Doch während Kant vier Jahre in polnischen Lagern verbrachte und dort die Anfänge jener politischen Dressur erfuhr, die sein künftiges Leben prägte, kam der Knabe Linus Cord in sowjetischen Gewahrsam, und das nur kurz. Er, der Siebzehnjährige, hatte sich für sechzehn ausgegeben und wurde von einer Soldatin, die ihm den Schwindel glaubte, heimgeschickt. Im sowjetischen Sektor Berlins, der späteren Hauptstadt der DDR, entwickelte er sich zwar zum braven Genossen, aber keineswegs zu einem Aktivisten nach Kantschem Vorbild.
Der Autor hält sich also einigermaßen fern von seinem Geschöpf, was er noch dadurch betont, dass er im Romantext ab und zu den "Erzähler" sprechen und vernünftige Mahnungen äußern lässt. Man kann durchaus nicht auf die Idee kommen, er trage seine eigene Geschichte vor oder wenigstens ein Stück davon. Damit wahrt er den Abstand, den er braucht, um ein Stasi-Märchen zu erzählen, ohne dass ein Bekenntnis daraus wird.
Was nun will Mielkes Ministerium von dem "beträchtlichen Essayisten"? Im ersten Halbjahr 1961, also noch vor dem Bau der Mauer, kommen nacheinander drei Offiziere der Staatssicherheit in dessen Wohnung, erst ein Leutnant, dann ein Hauptmann, dann ein Major. Sie alle fragen, ob Cord die Nummer seiner Wehrmachts-Erkennungsmarke noch weiß, und wenn nicht, ob er bereit sei, sie bei der West-Berliner Auskunftsstelle zu erfragen. Ein seltsames Begehren, das nicht nur den Heimgesuchten, sondern auch den Leser verblüfft. Welchen Nutzen verspricht sich die Stasi von einem Stückchen Blech, das dem Knaben Linus vor sechzehn, siebzehn Jahren um den Hals baumelte und bei seiner Gefangennahme auf einem Müllhaufen landete?
Den erwachsenen Linus macht das Gebohre langsam unruhig. Er beginnt, seine Vergangenheit nach irgendeinem Versehen oder Vergehen zu durchforschen, das ihn heute belasten könnte. Als Halbwüchsiger wurde er einmal Zeuge, wie sowjetische Kriegsgefangene auf einem norddeutschen Raketengelände misshandelt wurden, und verschwieg das bis in die Gegenwart. Und dann war da die Lüge, sein Geburtsjahr betreffend, die er auch nie eingestanden hat. Verlangen die Stasi-Offiziere deshalb so hartnäckig nach seiner Erkennungsmarke, weil sie ihn überführen wollen? Diesen Knabenstreich kann man ihm doch nicht ernsthaft vorwerfen? Linus überlegt, ob er endlich bekennen soll, tut es aber nie. Die Stasi-Frage bleibt. Im Interesse des Buchautors muss sie das auch, denn sie allein ist es, die dem Roman seinen Antrieb liefert und den Leser bei der Stange hält, auch dann, wenn ihn die wortreichen Dauerwiederholungen zu langweilen beginnen.
Wir begleiten also den verstörten Linus Cord auf seinem Weg vom Grübeln zum Entschluss, dem nämlich, endlich doch bei der West-Berliner Stelle nachzufragen. Dies allerdings ganz privat und ohne Wissen der Stasi-Offiziere. Was aber gewahrt er, und wir mit ihm, auf seinen Wegen durch das gegnerische West-Berlin? Die drei Ost-Herren, verkleidet und mit unübersehbaren Drohgebärden. Cord flüchtet heimwärts und bekommt bald darauf den unangenehm bekannten Besuch.
Dieses Mal erscheinen nicht nur Leutnant, Hauptmann und Oberst, sondern überdies noch ein General. Und der sagt endlich, was Sache ist: Sein Chef, der Minister, nimmt Anstoß an den frechen Gedanken so mancher Intellektueller und wünscht Gegenmaßnahmen. Dazu braucht man einen gehorsam funktionierenden Geistesmenschen und hat Linus Cord ausgesucht. Alles, was den in letzter Zeit beunruhigte: die Offiziersbesuche, die Fragen nach der Erkennungsmarke, die Schreckensauftritte im Westen, die offensichtliche Ausstattung seiner Wohnung mit Überwachungsgeräten - nur Theater, einzig dazu inszeniert, den Umworbenen aufzuschrecken und gefügig zu machen. Nichts davon wird es mehr geben, sobald er seine Pflicht tut. Ende der Operation: "Dreifaches Hackenknallen, vierfacher Händedruck, man fuhr davon."
Im Klappentext heißt es, das Ränkespiel habe Cord zerstört. Der Roman bestätigt das nicht, da verabschiedet er sich "erleichterten Herzens und erhobenen Hauptes". Aber vielleicht hat er nur nicht richtig begriffen, dass das dicke Ende mit Gewissheit noch nachkommt. Und wie es dann um Cord bestellt sein wird, das zu schildern erspart Kant seinem Romanhelden und seinen Lesern.
Was immer der Autor von den Methoden der Stasi erzählt, es fällt schwer, ihm zu glauben. In seinem Buch sind ihre Maßnahmen von sanfter Aufdringlichkeit und milder Gewalt, manchmal ein bisschen naiv bis zur Dämlichkeit. Wenn wir die Lektüre beendet haben, müssen wir uns eingestehen, dass sie keinen Nichteingeweihten klüger machen kann, jedenfalls nicht, soweit es das Ministerium für Staatssicherheit betrifft.
Doch etwas kann man aus Kants Geschichte lernen, nämlich, warum die DDR unterging. Ein Staat, der seine Gelder hinauswirft, nur um eigenwilligen Intellektuellen einen Maulkorb zu verpassen, der zu diesem Zweck teures Personal bis hinauf zum General aktiv werden und sogar im Feindesland Possen aufführen lässt, der kann ja nicht anders enden als im Ruin.
SABINE BRANDT
Hermann Kant: "Kennung". Roman. Aufbau Verlag, Berlin 2010. 250 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Den Eindruck eines Mannes, der über seine Vergangenheit nicht sprechen will, das "aber mit möglichst vielen Worten", hat Hermann Kant in seinem neuen Roman auf Thomas Winkler gemacht. Dessen Geschichte spielt Winkler zufolge wenige Monate vor dem Mauerbau und handelt von einem Literaturkritiker und der allgegenwärtigen Bespitzelung durch die Stasi, für die Kant einst selbst aktiv geworden ist. Das und auch die Seitenhiebe auf Günter Grass und dessen SS-Mitgliedschaft (der im wirklichen Leben Kant für einen auf ihn angesetzten Spitzel hielt, was Kant wiederum bestritt, wie Winkler schreibt) gibt dem Roman aus Sicht des Kritikers eine schlüpfrige, ja pikante Note. Spannender hätte Winkler gefunden, einmal von einem Insider zu erfahren, wie der Sozialismus durch seine "Späher des Friedens" behütet wurde. Stattdessen erzähle Kant seinen Lesern Märchen, strickt dieser Autor den Eindruck seines Kritikers zufolge unziemlich auch an einer dekonstruierenden Ironie, die am Ende auf Winkler lediglich wie das rostige Schutzschild eines Schriftstellers wirkt, der seine Verbitterung nicht eingestehen will.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Das Buch Hermann Kants ist keine Lüge. Es ist seine Geschichte, seine Art, die Geschichte zu sehen.« Volker Weidermann Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20100314