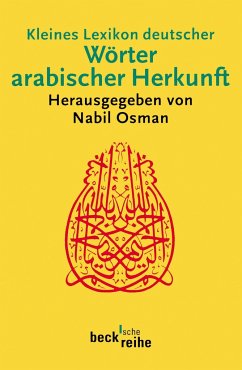Kiezdeutsch
Ein neuer Dialekt entsteht

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Machst du rote Ampel. Danach ich ruf dich an. Gibs auch ne Abkürzung. - Sätze wie diese sind nicht Horte von Sprachfehlern, sondern haben grammatische Eigenarten wie viele andere deutsche Dialekte auch. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt die renommierte Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese, dass Kiezdeutsch keine Kanak Sprak ist, kein Anzeichen mangelnder Integration und auch keine Gefahr für das Deutsche, sondern ein neuer, in dynamischer Entwicklung befindlicher Dialekt.Entwicklungen wie in Kiezdeutsch finden sich deswegen nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen unserer Umgangssp...
Machst du rote Ampel. Danach ich ruf dich an. Gibs auch ne Abkürzung. - Sätze wie diese sind nicht Horte von Sprachfehlern, sondern haben grammatische Eigenarten wie viele andere deutsche Dialekte auch. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt die renommierte Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese, dass Kiezdeutsch keine Kanak Sprak ist, kein Anzeichen mangelnder Integration und auch keine Gefahr für das Deutsche, sondern ein neuer, in dynamischer Entwicklung befindlicher Dialekt.
Entwicklungen wie in Kiezdeutsch finden sich deswegen nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen unserer Umgangssprache. Heike Wiese hört genau hin und analysiert, vor allem den Sprachgebrauch von Berliner Jugendlichen. Ihre Forschungen zeigen, mit welcher grammatischen Logik und sprachlichen Kreativität in Kreuzberg und anderen Kiezen Deutsch gesprochen wird allen sozialpolitischen Vor- und Fehlurteilen zum Trotz.
Entwicklungen wie in Kiezdeutsch finden sich deswegen nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen unserer Umgangssprache. Heike Wiese hört genau hin und analysiert, vor allem den Sprachgebrauch von Berliner Jugendlichen. Ihre Forschungen zeigen, mit welcher grammatischen Logik und sprachlichen Kreativität in Kreuzberg und anderen Kiezen Deutsch gesprochen wird allen sozialpolitischen Vor- und Fehlurteilen zum Trotz.