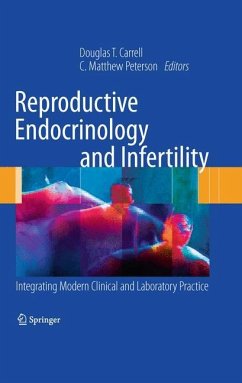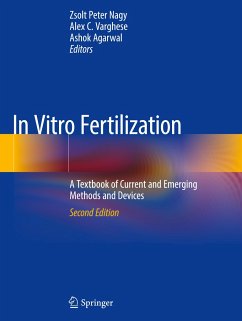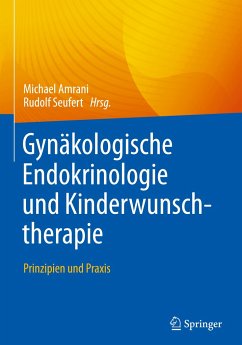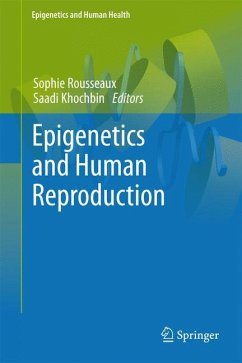Nicht lieferbar

Kinder machen
Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Samenspender, Leihmütter, Künstliche Befruchtung
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Leihmütter, Samenspender, künstliche Befruchtung: wenn die biologischen Elternnicht die sozialen sind ...Immer mehr Babys werden mit medizinischer Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure der Reproduktionsmedizin - doch was bedeutet das für unser Verständnis von Familie? Was passiert, wenn biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt?Von der Ukraine über Deutschland bis nach Kalifornien hat Andreas Bernard die maßgeblichen Orte, u.a. Samenbanken und Labore, aufgesucht, Eltern, Spender und Mediziner nach ihren Motiven befragt, die Sc...
Leihmütter, Samenspender, künstliche Befruchtung: wenn die biologischen Eltern
nicht die sozialen sind ...
Immer mehr Babys werden mit medizinischer Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure der Reproduktionsmedizin - doch was bedeutet das für unser Verständnis von Familie? Was passiert, wenn biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt?
Von der Ukraine über Deutschland bis nach Kalifornien hat Andreas Bernard die maßgeblichen Orte, u.a. Samenbanken und Labore, aufgesucht, Eltern, Spender und Mediziner nach ihren Motiven befragt, die Schicksale der Kinder recherchiert. Gleichzeitig hat er die Geschichte des Wissens um die Reproduktion aufgearbeitet und Erstaunliches zutage gefördert. In Verbindung aus Reportage und Wissenschaftsgeschichte gelingt ihm eine glänzend erzählte Bestandsaufnahme aller Aspekte der künstlichen Zeugung von Menschen - und was das für die Ordnung der Familie bedeutet.
nicht die sozialen sind ...
Immer mehr Babys werden mit medizinischer Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure der Reproduktionsmedizin - doch was bedeutet das für unser Verständnis von Familie? Was passiert, wenn biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt?
Von der Ukraine über Deutschland bis nach Kalifornien hat Andreas Bernard die maßgeblichen Orte, u.a. Samenbanken und Labore, aufgesucht, Eltern, Spender und Mediziner nach ihren Motiven befragt, die Schicksale der Kinder recherchiert. Gleichzeitig hat er die Geschichte des Wissens um die Reproduktion aufgearbeitet und Erstaunliches zutage gefördert. In Verbindung aus Reportage und Wissenschaftsgeschichte gelingt ihm eine glänzend erzählte Bestandsaufnahme aller Aspekte der künstlichen Zeugung von Menschen - und was das für die Ordnung der Familie bedeutet.