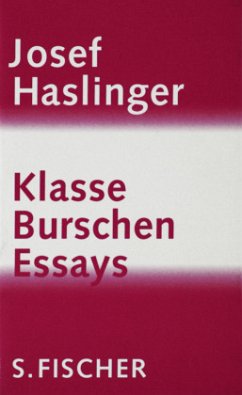Klasse Burschen, die Österreicher. Fröhlich verkünden sie den Glauben an das Gute in der Welt und zeigen stolz ihre Berge, Burgen und Barockkirchen her. Ein verantwortlicher Umgang mit seiner Geschichte aber fällt dem Land schwer. "Obszöner hat ein Land in Zeiten des Friedens noch nicht ausgesehen. "Zu dieser Überzeugung gelangt Josef Haslinger in seinen neuen Essays, in denen er die gesellschaftliche und politische Lage Österreichs analysiert. Er fordert,sich der Geschichte zu stellen, verweist auf das Versagen der Sozialdemokratie und beschreibt die zweifelhafte nationale Identität des Landes, dessen Geschichtslügen und Selbstinszenierungen. Doch bleiben seine hellsichtigen Analysen nicht auf die Grenzen Österreichs beschränkt. Zu Europa oder den Veränderungen in der Asylgesetzgebung bezieht er ebenso Position wie zur derzeitigen Kulturpolitik. Josef Haslinger versteht sich als ein Schriftsteller, für den Ästhetik und Ethik, Literatur und Moral keine getrennten Sphären sind. Wie auch in seinen Romanen "Der Opernball "und "Das Vaterspiel ",deckt er in seinen Essays die Wunden der österreichischen Gesellschaft auf. Er benennt Verdrängtes und erinnert an Verschwiegenes. Gerade angesichts der politischen Entwicklung in Österreich und dem bislang unaufhaltsamen Aufstieg von Jörg Haider sind Josef Haslingers hochaktuelle Essays unverzichtbar geworden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Österreich hat mehr Intellektuelle aufzubieten, die auch tatsächlich etwas zu sagen haben, als die Bundesrepublik, meint Uwe Schütte. Das liegt seiner Ansicht nach unter anderem an Jörg Haider, den Haslinger in seinem vierten Essayband weniger als Person denn als Phänomen ergründet, das der Autor bis zum Bürgerkrieg von 1934 zurückverfolgt. Besonders gefällt Schütte die Kontrastierung des politischen Geschehens in Österreich durch Beobachtung des Auslands: da schaut einer über den Tellerrand, lobt Schütte, und begegnet z. B. einem anderen Rechtspopulisten, nämlich George Bush im Wahlkampf; oder Haslinger grüble über die Europäische Gemeinschaft nach, die er für eine hehre kulturelle Idee und ein pragmatisches Zweckbündnis zur Wahrung ökonomischer und sicherheitspolitischer Interessen halte. Der Band versammelt Texte aus den letzten acht Jahren, die Schütte allesamt spannender findet als den zuletzt von Haslinger vorgelegten Roman.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Josef Haslinger empört sich bis zum Schulterzucken
Es ist schön, daß sich auch Josef Haslinger öffentlich kritische Gedanken zum Weltenlauf macht. Weniger schön ist, daß weder er noch sein Verlag vor der verbreiteten Krankheit gefeit sind, die alles, was ein Schriftsteller an tagespolitischen "Interventionen" verfaßt, automatisch der nobleren Zweitverwertung in Buchform für würdig und wert befindet.
"Klasse Burschen" heißt Haslingers neuer Essay-Band, und ein wenig wird mit dieser Titelgebung wohl darauf spekuliert worden sein, daß der interessierte Leser auch von Haslinger Phänomene der österreichischen Seele oder Politik erklärt bekommen möchte. Darauf lassen jedenfalls Kapitelüberschriften wie "Der Haider-Wähler" oder "Das Phänomen Haider" schließen. Bei der Lektüre entpuppen sie sich allerdings entweder als Etikettenschwindel oder aber als Provokationen folgenden Inhalts: Man kann Österreich nicht verstehen, daher soll niemand Erkärungen erwarten. Oder was sonst soll man davon halten, wenn Haslinger unter dem Titel "Der Haider-Wähler" bloß traurig darüber sinniert, daß er noch nie einen solchen getroffen hat, weil sich Haider-Wähler offenbar bloß in der Wahlzelle bekennen? Und warum serviert er uns ein "Phänomen Haider"-Kapitel, hinter dem sich nichts anderes verbirgt als Haslingers Rezension vierer einschlägiger Haider-Erklärbücher?
Dabei scheint der Band mit einem Donnerschlag zu beginnen: Haslinger schildert den Tod seiner Tante, die aus Schreck darüber starb, daß sich eine der Donnerstags-Demonstrationen vor ihrem Haus, dem Karl-Marx-Hof, versammelte - sechsundsechzig Jahre zuvor hatte sie die Gefechte des österreichischen Bürgerkriegs am selben Ort miterlebt. Nun muß niemand befürchten, daß Haslinger den Tod seiner Tante den regierungskritischen Demonstranten des Jahres 2000 in die Schuhe schiebt. Das wird höchstens die "Kronen Zeitung" tun, sobald sie dieses Buch in die Hand bekommt - sie stellt Demonstranten ja gern als gemeingefährlich und nur des Wegsperrens würdig dar. Nein, Haslinger bezeichnet seine Tante als das "letzte Opfer des Bürgerkriegs", um daraufhin den schwierigen Umgang Österreichs mit seiner Nazi-Vergangenheit vom Jahr 1934 her zu erklären. Das ist nicht uninteressant und mag manchem deutschen Leser unbekannt sein - neu ist es wahrlich nicht. Seit mindestens zehn Jahren wird verstärkt auf den Umstand hingewiesen, daß in der österreichischen Arbeiterschaft der Zwischenkriegszeit der Haß auf die "bürgerlichen" Austrofaschisten viel größer war als auf die Nazis, die ja damals, genau wie die Sozialdemokraten, eine verfolgte, verbotene Partei waren. Den praktischen Nutzen dieses Wissens, seine Anwendbarkeit zur Erklärung der vielen Rätsel der österreichischen Gegenwart sind aber auch all die Austrofaschismus-Theoretiker vor Haslinger bisher schuldig geblieben.
Den Rätseln der österreichischen Gegenwart erliegt Haslinger jedenfalls so sehr, daß ihm die Sprache ausgeht und er sich nur noch auf Platitüden verlassen kann: "Das Phänomen Haider funktioniert wie ein Zweikomponentenkleber aus Solidarität und Hetze, der sich im Kopf des Wählers zu einer zähen, klebrigen Masse verdichtet." Wer Altbekanntes so zäh verdichtet, kann bald seine eigenen Sätze auf sich selbst anwenden: "So mancher, der sich Haider im medialen Licht nähern wollte, ging im medialen Regen nach Hause." Nun ja. Aber es geht hier nicht nur um Haider, sondern auch, zum Beispiel, um den Kosovo-Krieg. Oder um das Gedenkkonzert, das die Wiener Philharmoniker zum 55. Befreiungstag des Konzentrationslagers Mauthausen dortselbst gaben: Beethoven spielten sie, gar die "Ode an die Freude", und nicht nur Haslinger hat sich damals darüber moralisch empört.
Diesen beiden Essays sollte man sich am besten von Haslingers eigenem theoretischen Unterfutter her nähern: Nicht zufällig heißt ein Text ganz am Beginn des Buches "Die Schriftsteller und die Moral". An diesem Stück nun läßt sich, leider, das ganze Dilemma dieses Essay-Bandes ablesen. Denn erst holt Haslinger aus, denkt vorwärts, rückwärts und im Kreis: Wann haben die Künstler eigentlich begonnen, zur Beurteilung ihrer Werke bloß ästhetische anstatt moralischer Kriterien zuzulassen? Er versteht, sagt er, daß die Frage, was die Literatur eigentlich leisten solle, als naiv angesehen werde. Er verstehe auch, daß seit den Erfahrungen mit der DDR Autoren einen großen Bogen um politisches Engagement machten (hier versteht er mehr als wir). Dann bekennt er offenherzig: "Für mich persönlich wäre es eine gekünstelte Selbstkasteiung, in dem Augenblick, in dem ich an einem neuen Text schreibe, alle politischen und sozialen Konflikte zu vergessen, die mich formten und täglich umgeben." Und dann kommt - nichts mehr. Der Text "Die Schriftsteller und die Moral" bleibt allen Ernstes gedanklich hier stecken. Kein beherztes Plädoyer etwa für eine neue Moral in der Literatur, nein. Auch keines dagegen. Haslinger zuckt bloß verwirrt die Schultern.
Völlig offensichtlich tritt seine argumentative Unschärfe in dem Text über das Mauthausen-Konzert zutage. Ja, es mag furchtbar geschmacklos sein, an diesem Ort Beethoven zu spielen anstelle von Mozarts Requiem, wie Haslinger halbherzig vorschlug. Es mag auch unangenehm berühren, daß es einen Verein mit dem nicht ganz glücklich gewählten Namen "Mauthausen aktiv" gibt, der sich für diesen Festakt stark gemacht hat. Nur sollte man dabei nicht unterschlagen, daß in "Mauthausen aktiv" die ehemaligen Häftlinge organisiert sind, und wer will ihnen vorschreiben, wie man den Jahrestag ihrer eigenen Befreiung angemessen zu feiern hat? Die einzige Rolle, die einem hier sonst noch offenstünde, ist die eines Vormunds der Ermordeten. Wie hätten sie sich diese Feier gewünscht? Haslinger scheint es genau zu wissen: So nicht. Er schwingt die plumpe Keule der Empörung und schreibt das Ereignis zu einem nationalen Skandal hoch: "Dieses Konzert war ein Affront durch und durch."
Das Problem mit Josef Haslinger ist, daß viele seiner "moralischen Positionen" ja an sich vernünftige, humanistische sind, so sehr, daß man ihnen weitere Verbreitung in seinem Heimatland wünschen würde. Um so grimmiger stimmt es, wenn er sie so naiv, so achtlos, so angreifbar präsentiert und damit jenen Zynikern scheinbar recht gibt, die ethische Grundsätze und politische Sensibilität für das Hobby heilloser Idealisten halten.
EVA MENASSE
Josef Haslinger: "Klasse Burschen". Politische Essays. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 256 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Österreich hat mehr Intellektuelle aufzubieten, die auch tatsächlich etwas zu sagen haben, als die Bundesrepublik, meint Uwe Schütte. Das liegt seiner Ansicht nach unter anderem an Jörg Haider, den Haslinger in seinem vierten Essayband weniger als Person denn als Phänomen ergründet, das der Autor bis zum Bürgerkrieg von 1934 zurückverfolgt. Besonders gefällt Schütte die Kontrastierung des politischen Geschehens in Österreich durch Beobachtung des Auslands: da schaut einer über den Tellerrand, lobt Schütte, und begegnet z. B. einem anderen Rechtspopulisten, nämlich George Bush im Wahlkampf; oder Haslinger grüble über die Europäische Gemeinschaft nach, die er für eine hehre kulturelle Idee und ein pragmatisches Zweckbündnis zur Wahrung ökonomischer und sicherheitspolitischer Interessen halte. Der Band versammelt Texte aus den letzten acht Jahren, die Schütte allesamt spannender findet als den zuletzt von Haslinger vorgelegten Roman.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH