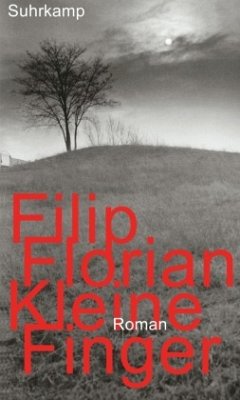In einem Karpatenstädtchen wird in den Ruinen einer römischen Festung ein Massengrab entdeckt. Alles scheint auf ein Verbrechen aus kommunistischer Zeit hinzudeuten. Da die Bevölkerung den Ermittlungen der zuständigen Militärstaatsanwälte nicht traut, werden argentinische Experten nach Rumänien geholt, die mit der Suche und Identifizierung der "Verschwundenen", den Opfern der Junta, befaßt waren.Die Suche nach der Wahrheit, die nur zersplittert, perspektivisch, als Wahrheit einzelner Menschen zu haben ist, bestimmt auch die Dramaturgie des Romans. Im Zentrum steht der Archäologe Petrus, der sich der allgemeinen Hysterie entzieht und eigene Forschungen anstellt. Morgens sitzt er in der Gemeindebibliothek, die Nachmittage verbringt er bei Tante Paulina, die ihm aus dem Kaffeesatz liest, bei Lady Embury, der Witwe eines britischen Erdölingenieurs, oder bei Dumitru M., einem früheren Unternehmer, der nach dem Krieg enteignet wurde. Die abenteuerlichen und wundersamen Lebensgeschichten, auf die Petrus stößt und die Filip Florian mit großer Sprach- und Imaginationskraft erzählt, lassen Epochen des 20. Jahrhunderts in Europa und Lateinamerika wiederauferstehen. Sein Roman schildert eine von Diktaturen malträtierte Welt, die sich nach Gerechtigkeit sehnt.

Botschaften der Baumrinde: Filip Florians magisch-realistischer Roman über ein mysteriöses Massengrab in Rumänien
Archäologie kann ein Politikum sein. In Rumänien pflegt man bis heute die umstrittene "Kontinuitätstheorie", der zufolge es dort seit der alten römischen Provinz Dakien durchgängig eine rumänische Besiedlung gegeben haben soll. Unter Ceausescu waren solche Behauptungen, die vor allem auf territoriale Ansprüche zielen, Staatsdoktrin. 1980 ließ der "Conducator" sogar den zweitausendfünfhundertsten Jahrestag der dakischen Staatsgründung feiern. Während die Historiker Ceausescu als Erfüller der rumänischen Geschichte priesen, mühten sich die Archäologen, im Erdboden schlagkräftige Beweise für die Kontinuitätstheorie zu finden.
Um die Instrumentalisierung der Geschichte - unter etwas anderen Vorzeichen - geht es auch in "Kleine Finger", dem Debüt des 1968 geborenen Rumänen Filip Florian. Den Stoff für seinen Nachwenderoman entdeckte Florian 1992 als Korrespondent von Radio Free Europe: Im Hof eines alten Gutshauses bei Bukarest wurden bei Bauarbeiten menschliche Knochen gefunden. Schnell glaubte die Öffentlichkeit an ein kommunistisches Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft trat auf den Plan - bis sich die rund dreihundert Skelette als Überreste von Pesttoten erwiesen. "Die damalige Aufregung", so Filip Florian im Gespräch, sei in ihm "zu einem Keim geschrumpft, aus dem später das Buch gewachsen ist".
Auch in "Kleine Finger" entdecken Archäologen bei Grabungen an einem römischen Castrum in den Karpaten ein Massengrab. Sofort behauptet der örtliche Polizeichef, dass es sich dabei um Terroropfer der fünfziger Jahre handele. Journalisten und ein Vertreter der ehemaligen Politischen Häftlinge reisen an, um den vermeintlichen Tatort zu inspizieren. Nur wenige, wie der Archäologe Petrus, zweifeln an der Terrortheorie. Während des Grabungsstopps forscht er im Gemeindearchiv und spricht mit den Bewohnern des kleinen Kurortes.
Wie in einem Panoptikum werden nun die Schicksale aufgefächert. Da ist der Vorkriegs-Industrielle Dumitru, der nach seiner Enteignung zum Kranführer degradiert wurde. Der alte Mann lebt in einer Dachkammer, fängt Tauben und bereitet daraus Festmahle. Und da sind die betagten Damen Tante Paulina und Lady Embury. Erstere prophezeit sich selbst erst ein "schönes Sümmchen" aus dem Kaffeesatz und findet dann einen Goldschatz in der Küchenwand. Letztere ist die Witwe eines britischen Lords, der in der Zwischenkriegszeit bei einer Ölgesellschaft in Rumänien beschäftigt war. Über Petrus' Unterhaltungen gerät die Geschichte vom Massengrab vorerst aus dem Blick. Dafür entsteht aus den Erinnerungen eine Vorstellung vom Leben im Kommunismus, aber auch von der fernen k. u. k. Vergangenheit, vom Rumänien der Vorkriegszeit, von Faschismus und Krieg.
Neben der Handlung um den Archäologen, der eine Liebschaft mit der Nichte der Lady beginnt, rankt sich ein zweiter Erzählstrang um den Mönch Onufrie. Als politisch Verfolgter hatte der sich viele Jahre in einer Berghöhle versteckt und dort mit einer Bussardfeder und Heidelbeersud sein "Evangelium" auf Baumrinden geschrieben. Onufrie ist eine von Monstrositäten wie von Wundern umflorte Gestalt. Seine mit ihm schwangere Mutter schlitzte Dutzende von Enten auf, um ihre Leber roh zu verschlingen. Onufries Haar wächst rasend schnell, mehrfach will er die Madonna gesehen haben, einmal folgt ihm ein Bär wie ein Hündchen. Als er von seiner Einöde herabsteigt und das Massengrab segnet - wodurch die beiden Handlungsstränge des Romans zusammenfinden -, stürzt sich die Presse auf den Mann.
Zum magisch-realistischen Timbre des Romans passt, dass ausgerechnet argentinische Junta-Experten das Rätsel des Massengrabs lösen. Filip Florians Buch bringt stumme Dinge - eine verblasste Fotografie, einen alten Prägestempel - zum Sprechen und macht den Leser zum Gräber und Archäologen. Es zeigt sich, dass ausgerechnet der Urheber der Massakerthese zu den alten Seilschaften gehört. Und die verschwundenen Knochen von einem kleinen Finger aus dem Grab hat der Staatsanwalt, dem ein Gefangener einst den kleinen Finger abgebissen hat, wie Fetische gehortet. Weil die Verstrickungen tief sind, ist eine kritische Untersuchung nicht erwünscht.
Filip Florian weiß, dass die Vergangenheit eine Gesellschaft im Griff haben kann wie eine lange, hartnäckige Krankheit. Sein kleiner, dichter Roman setzt ein Bild der Geschichte aus verschiedenen Stimmen, eben aus vielen kleinen Knochen zusammen - und nur nach einer solchen Verarbeitung ist Heilung denkbar.
JUDITH LEISTER
Filip Florian: "Kleine Finger". Roman. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 269 S., geb., 22,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Uwe Stolzmann hat die erzählerische Souveränität dieses Debütromans, den der 1968 geborene rumänische Autor Filip Florian vorgelegt hat, ziemlich imponiert, wie er in seiner wohlwollenden Kritik deutlich macht. Bei Ausgrabungen in einer Kurstadt in den Karpaten wird ein Massengrab entdeckt, das man für eine mörderische Hinterlassenschaft des Ceausescu-Regimes hält; Bukarest fordert Hilfe für die Aufklärung aus Argentinien an, wo man Erfahrungen mit Staatsterror hat, die argentinischen Anthropologen allerdings finden heraus, dass es sich bei den Toten um bei einer Pestepidemie vor 200 Jahren Umgekommene handelt. Soweit die "bizarre und beklemmende" Handlung des schmalen Romans, der laut Rezensent nach den Bauprinzipien einer klassischen Novelle funktioniert. Stolzmann findet es beeindruckend, wie Florian dieses zwischen Groteske und Grauen changierende Spiel mit dem Thema "verdrängte Schuld" und "allgemeines Misstrauen", die in Hysterie eines ganzen Ortes mündet, inszeniert, auch wenn er leise anmerkt, dass der Text mitunter "arg ambitioniert" daherkommt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH