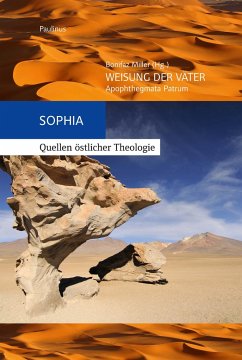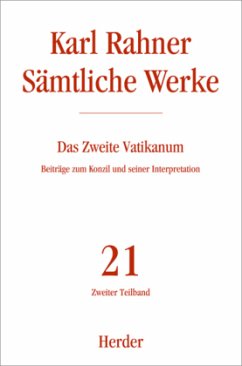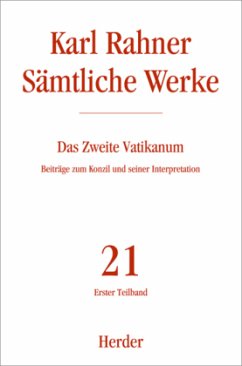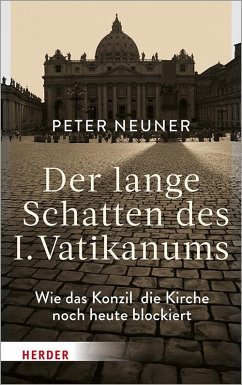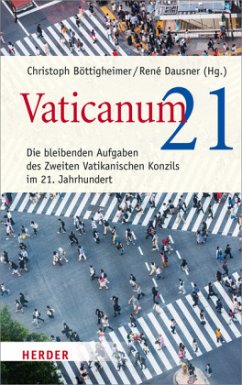Kleines Konzilskompendium
Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Allgemeine Einleitung - 16 spezielle Einführungen - ausführliches Sachregister
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
30,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Bereits in der 35. Auflage mit über 220.000 Exemplaren verbreitet, bietet das "Kleine Konzilskompendium" alle Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, die unter Mitarbeit der Verfasser im Auftrag der deutschen Bischöfe übersetzt wurden. Eine hinführende allgemeine Einleitung sowie 16 spezielle Einführungen aus der Feder Karl Rahners und Herbert Vorgrimlers erschließen die Texte und bieten eine zuverlässige, sachliche und präzise Kurzkommentierung. Das sorgfältig erarbeitete, ausführliche Sachregister führt zu allen wichtigen Details in den Originaltexten und trägt zum Verständnis von Sinn und Gehalt der Konzilstexte bei.