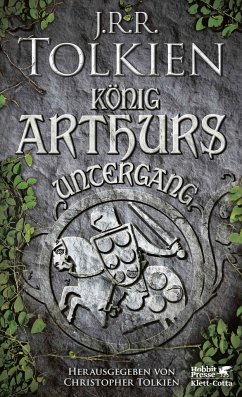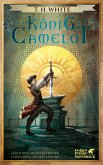Tolkien, der wichtigste Fantasyautor der Neuzeit, wendet sich einem der größten Sagenstoffe aller Zeiten zu: der Sage von König Arthur. Ein Poem von berückender Schönheit.
Das große Epos um Arthur erzählt, wie der tapfere König sich zum Waffengang ostwärts in ferne, heidnische Länder begibt. Während der König außer Landes kämpft, verliebt sich der Ritter Lancelot in Arthurs Frau Guinever und schafft damit einen unüberwindlichen Konflikt. Als auch noch der verräterische Mordred die Macht an sich zu reißen versucht, treibt die Handlung einem Abgrund entgegen ... Neben der Edda und dem Nibelungenlied ist die Arthursage die wichtigste Quelle aller neueren Fantasyliteratur, die hier erstmals in J. R. R. Tolkiens eigener Fassung vorliegt. Neben der kongenialen Übersetzung von Hans-Ulrich Möhring enthält diese Ausgabe auch den Text des englischen Originals.
Das große Epos um Arthur erzählt, wie der tapfere König sich zum Waffengang ostwärts in ferne, heidnische Länder begibt. Während der König außer Landes kämpft, verliebt sich der Ritter Lancelot in Arthurs Frau Guinever und schafft damit einen unüberwindlichen Konflikt. Als auch noch der verräterische Mordred die Macht an sich zu reißen versucht, treibt die Handlung einem Abgrund entgegen ... Neben der Edda und dem Nibelungenlied ist die Arthursage die wichtigste Quelle aller neueren Fantasyliteratur, die hier erstmals in J. R. R. Tolkiens eigener Fassung vorliegt. Neben der kongenialen Übersetzung von Hans-Ulrich Möhring enthält diese Ausgabe auch den Text des englischen Originals.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Nicht weniger als eine literarische Sensation ist für Christian Thomas die von J.R.R. Tolkien verfasste Version der Artus-Sage, auch wenn er sich beeilt, die Erwartungen nicht allzu sehr überschäumen zu lassen: Zum einen handelt es sich um ein Fragment, dem entscheidende Handlungselemente fehlen, zum anderen werden sich Tolkien-Fans an einen völlig neuen Sound gewöhnen müssen - und Artus-Fans an ein paar waghalsige Variationen, erklärt der Rezensent. Sehr hilfreich findet er den Herausgeberkommentar von Tolkiens Sohn Christopher, der zwei Drittel des Buches ausmacht und, "gut verborgen im Dickicht der Interpretation", hilfreiche Lektürehinweise zu geben vermag. Ein Sonderlob gibt es außerdem für die "fabelhafte Übertragung" der stabreimseligen Verse durch Hans-Ulrich Möhring.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein großes Werk eines großen Autors, der ein weiteres Mal seine Tätigkeit als Literatur- und Sprachwissenschaftler mit der Kunst des phantastischen Erzählens zusammenführt. "König Arthurs Untergang" sollte in keiner Tolkiensammlung fehlen.« Daniel Bauerfeld, Nautilus Abenteuer & Phantastik, September 2015 Daniel Bauerfeld Nautilus 20150901