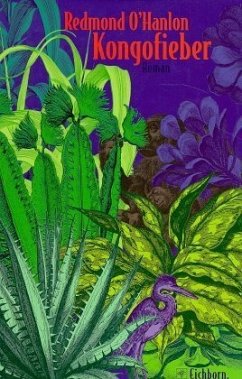Wo Afrika am schwärzesten ist, begeben sich Redmond und Lary auf die Suche nach Mokele-mbembe, dem Kongo-Dinosaurier. Bevor sie im Einbaum, zu Fuß und auf allen vieren unterwegs sind, müssen sie das Vertrauen der käuflichen Bürokraten in der Hauptstadt erwerben. Ihr Führer ebnet den Weg. Malerische Flussläufe, Papageien und Krokodile, Gorillas und Waldelephanten, Zauberer und Pygmäen begleiten sie. Je tiefer sie in das feuchtheiße Labyrinth vordringen, desto unheimlicher wird ihre Reise. Nur der archaische Geisterglaube mit seinen grausamen Ritualen scheint stark genug, den Horror zu bändigen. Kongofieber ist das lebendige Porträt eines Landes und ein Stück faszinierender Natur- und Evolutionsgeschichte. Ein Abenteuerroman von großer erzählerischer Kraft.

Unter Reisenden: Redmond O'Hanlon hat das "Kongofieber"
"Sie müssen wissen", erklärt Redmond O'Hanlon, als die Visaverhandlungen ins Stocken geraten sind, dem Staatssekretär im Forschungsministerium zu Brazzaville, "daß ich ein darwinistischer Marxist mit einem großen Interesse an der Zauberei bin." - "Ja, wenn das so ist", erwidert Jean Ngatsiebe mit einem "brüllenden Lacher" und stellt O'Hanlon und seinem Gefährten Lary Shaffer umgehend ein Sechsmonatsvisum aus. Somit steht der Reise in die unwegsame Nordostprovinz, wo am Lac Télé der Kongo-Saurier Mokélé-mbembé besucht werden soll, nichts mehr im Wege, könnte denken, wer den Kongo nicht kennt, seine Marxisten und Zauberer, seine Viren und Wälder.
O'Hanlon hat, ehe 1992 das kommunistische Regime des Colonel Denis Sassou-Nguesso in Bürgerkriegswirren versank, die fast unzugängliche Volksrepublik Kongo bereist. Warum hat er sich diesen "1000-Volt-Dauerkulturschock" angetan? Jedenfalls ist O'Hanlon nicht als politischer Journalist nach Brazzaville gekommen, nicht als Anthropologe, der auf Stammesstrukturen und Polygamie einen akademischen Blick wirft, und auch nicht als Entwicklungshelfer. Für eine Dienstreise ist ohnehin zu viel Whisky im Spiel. Andererseits hat die Tour durchaus professionelle Züge. Wenn man O'Hanlon charakterisieren will, dann am ehesten als einen naturkundlich auf hohem Niveau dilettierenden Reiseschriftsteller und Exzentriker, zu dessen Vorlieben es gehört, alle paar Jahre auf den Vorposten des Überlebens - Borneo, Amazonien - seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen und seine Eindrücke zu gelehrsamen, witzigen und beunruhigenden Berichten zu verarbeiten. "Kongofieber" ist ein wunderbares Buch. Es ist glänzend geschrieben, randvoll mit pointierten Beobachtungen und albtraumhaften Situationen und obendrein eine hohe Schule des Understatements und der Selbstironie. Nach getaner Lektüre möchte man es gleich wieder von vorn beginnen. "Kongofieber", dieser darwinistische Horror-Roman, wirkt ansteckend.
O'Hanlons Abenteuerreise beginnt in Poto-Poto, dem Armenviertel von Brazzaville, bei einer Feticheuse. "Wenn Sie einen Tag länger als zwei Monate bleiben, werden Sie sterben", lautet ihre Prophezeiung. Schlecht für Redmond oder Redso, wie ihn sein Kompagnon nennt, denn er hatte eigentlich an sechs Monate gedacht. Als Lotsen zum Lac Télé hat er Marcellin Agnagna verpflichtet, den obersten Naturschützer der Republik, einen Mann, der in Kuba und Frankreich Zoologie studiert hat. Im Rucksack führt Redmond neben Gastgeschenken und Medikamenten einen wissenschaftlichen Handapparat mit sich: Serles und Morels "Vögel Westafrikas", Haltenorths und Dillers "Säugetiere Afrikas", Williams' "Bestimmungsbuch der afrikanischen Schmetterlinge" und manches mehr, Bücher, die er schon aus der Bibliothek seines Vaters, eines Pfarrherrn in Wiltshire und zeitweiligen Abessinien-Missionars, kennt.
So ausgerüstet, kann die Reise in die Likouala-Region, eines der größten Sumpfwaldgebiete der Erde, beginnen. Von Magenverstimmungen abgesehen, geht es auf dem Dampfschiff, das die Reisenden kongo- und oubanguiaufwärts nach Impfondo bringt, noch relativ beschaulich zu. Eine Strecke, die André Gide 1925 "hoffnungslos monoton" vorkam, während O'Hanlon und Lary, der Ethnologe aus Plattsburgh, überall etwas zu beobachten, das heißt zu unterscheiden haben, so etwa den Keulenhorn- vom Waldnashornvogel.
Von Impfondo aus geht die nun durchweg ungemütliche Reise teils mit dem Boot, teils zu Fuß weiter. Erstes Ziel ist ein Pygmäencamp im Sumpfwald. Dort werden die Pygmäen von den örtlichen Bantus wie Sklaven gehalten und vor den Weißen auf Kommando zum Tanzen gebracht. Viele Pygmäen leiden entsetzlich an der Himbeerseuche - "etwas Ähnliches wie Syphilis, hat aber mit Sex nichts zu tun", wie der in diesen Dingen beschlagene Marcellin erklärt. Eine einzige Injektion zum Kostenpunkt von vierzig Pennies könnte sie heilen. Redso und Lary helfen als geständige Szientisten, wo und wie sie können, nämlich mit Chemie.
Marcellin, der naturwissenschaftlich geschulte Reisebegleiter, sieht das grundsätzlich genauso. Er ist aber auch der Enkel von Dokou, einem großen Feticheur im Dorf Makao. Also glaubt er sowohl an die Wissenschaft, in der er sein Diplom erwarb, wie auch an die "Wissenschaft der Menschen" in den Wäldern, an die "afrikanische Logik", den schönen "klinischen Wahnsinn" seiner Landsleute. Zum Schutz überreicht Dokou Mr. Redmond einen Fetisch. Er enthält den Finger eines Kindes. Fetischismus, dieser ganze "Zauberkram", sei "Quatsch", meint der handfeste Lary. O'Hanlon sieht die Sache schon differenzierter: Der Fetisch, meint er, habe auf psychische Systeme, die zwischen innen und außen nicht unterscheiden könnten, stabilisierende Wirkung. Ein Fetisch hält den Horror in Grenzen, ist aber zugleich die Ursache für neuen Horror. Denn wer kann sicher sein, daß sein Zauber nicht durch einen Gegenzauber entkräftet wird?
Manchmal kann er "die Amerikaner" nicht verstehen. Sie wollen erstens keinen Sex mit kongolesischen Frauen und glauben zweitens, es gebe einen Unterschied zwischen ihrem Rosenkranz-Fetisch und einem afrikanischen "Ju-ju" oder "Gris-gris." Aber schon bei der nächsten Gelegenheit träumt Marcellin laut von einem Leben als weißer Farmer in Zimbabwe, oder er möchte mit Redmonds Hilfe Professor in Oxford werden.
Wenn die Malariaattacken am heftigsten sind und die Angst vor nächtlichen Banditen am größten ist, wenn zum Mittagessen wieder nur Elefantennase auf dem Teller liegt, flüchtet sich der Stoiker O'Hanlon in Erinnerungen: Ich "versuchte", heißt es einmal, "an etwas Nettes zu denken". Mal führt ihn die Erinnerung zurück in die Kindheit im pastoralen England, mal ruft sie naturkundliche Lektüren ins Gedächtnis. Einmal schiebt sich Bruce Chatwin dazwischen, "der einzige meiner Bekannten, der an Aids gestorben war". Dem Bruder im Geiste widmet er ein liebevolles Porträt, in dem der Spott über Chatwins mondänes Nomadentum nicht fehlt. Wer war zum Beispiel "Bunin", von dem Chatwin kurz vor seinem Tod auf einmal sprach? "Bei Bruce konnte man nie sicher sein. Ein neuer Strawinski aus Albanien? Der Rufname des letzten Sklaven von Zentral-Mali? Ein patagonischer Leuchtturmwärter? Schriftrolle 238 ¿ aus einer Höhle am Negev? Oder nur der Exilkönig aus Tomsk, der ihn zum Tee besucht hatte?"
Diese Art Reiseschriftstellerei ist mit Schmock-Risiko verbunden. O'Hanlon entgeht ihm unter anderem dadurch, daß er sich zum Unglücksraben stilisiert, zum am schlechtesten riechenden Mann unterm Kreuz des Südens, der vom Lac Télé statt Saurierfotos ein Gorillababy mitbringt, dessen Ziehvaterschaft er übernommen hat.
O'Hanlons Reisebericht liegt eine Anti-Klimax zugrunde. Lary desertiert vorzeitig ins heimatliche Plattsburgh; und brenzlig wird es nur noch einmal im Weiler Boha, wo Marcellin Persona non grata ist, weil er den Dorfhäuptling ins Gefängnis werfen ließ. Ob sich wohl am unheimlichen Lac Télé, dem Loch Ness Zentralafrikas, der Dinosaurier zu erkennen gibt? Jedenfalls findet man hier Tigerginsterkatzen und Sumpfmangusten, die O'Hanlon mit den Bildern im Bestimmungsbuch abgleichen kann. Langsam reift in ihm die Einsicht, zwar am richtigen Ort, doch leider "67 Millionen Jahre zu spät" angekommen zu sein. Wie auch immer, für seine Leser hat sich O'Hanlons Reise ins finstere Erdaltertum auf jeden Fall gelohnt. CHRISTOPH BARTMANN
Redmond O'Hanlon: "Kongofieber". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Chris Hirte. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1998. 656 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ein Meisterwerk" (Observer Review) "Eines der besten Bücher des Jahres 1997." (Bill Buford, New Yorker) "Unter den zeitgenössischen Schriftstellern hat O'Hanlon die beste Nase für die letzten weißen Flecken unseres Globus und den elegantesten Erzählstil." (Washington Post Book World)