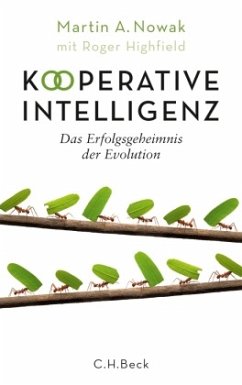Martin Nowak, ein weltweit führender Experte im Bereich Evolution und Spieltheorie, erklärt in seinem fesselnden, zugänglichen Buch, warum Kooperation - und nicht Egoismus - der Schlüssel zum Spiel des Lebens ist. Die brillante Antwort auf Frank Schirrmachers Bestseller "Ego". Im Spiel des Lebens treibt uns das Streben nach Erfolg an. Wir alle wollen Sieger sein. Selbst unsere Gene, so heißt es, seien egoistisch. Aber Konkurrenz erzählt nicht die ganze Geschichte der Biologie. Etwas Grundlegendes fehlt. Um zu überleben, betreiben die Geschöpfe jeder Spezies und auf jeder Stufe der Komplexität auch Kooperation. In der menschlichen Gesellschaft ist Kooperation sogar allgegenwärtig. Selbst einfachste Abläufe bestehen aus mehr Zusammenarbeit, als man meinen könnte. Dabei beschränkt sich Kooperation nicht darauf, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Kooperation bedeutet darüber hinaus, dass Menschen, die potenziell Konkurrenten sind, stattdessen beschließen, einander zu helfen."Kooperative Intelligenz" entschlüsselt das Rätsel, wie es dazu kommt und warum auf lange Sicht Kooperation immer gewinnt. Es erweitert unser Verständnis von Evolution und Solidarität und hat das Zeug, Debatten auszulösen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schöner Ratschlag, mit der nächsten Stufe der Kooperation unter den Menschen, die nötig sei, um die Zukunft zu meistern. Rezensent Helmut Mayer scheint nicht so recht dran zu glauben. Dabei erfüllt ihn die akademische Karriere des Autors bis zum Initiator des Instituts für evolutionäre Dynamik in Harvard mit Hochachtung. Doch wenn Martin Nowak und sein Koautor Roger Highfield ein populäres Buch vorlegen und die Entwicklung der Kooperation sowie ihre verschiedenen Spielarten darstellen, kommen zumindest dem Rezensenten Zweifel an der Tadellosigkeit der hier bemühten, wenngleich sehr eleganten Mathematik.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kooperieren geht über schnelles Maximieren. Recht oft zumindest. Martin Nowak und Roger Highfield führen vor, wie sich evolutionäre Prozesse mit Mitteln der Spieltheorie modellieren lassen.
Von Helmut Mayer
Martin Nowak ist einer der führenden Köpfe auf dem Feld der mathematischen Modellierung evolutionärer Prozesse. Eine beeindruckende Karriere führte den Wiener Mathematiker über Oxford und Princeton nach Harvard, wo der heute Achtundvierzigjährige das von ihm eingerichtete Institut für evolutionäre Dynamik leitet. Woran schon zu sehen ist, dass dieses Feld viel beachtet wird. Es verspricht schließlich, mathematische Übersichtlichkeit in notorisch unübersichtliche, meist schwer empirisch auszutestende und von vielen Faktoren abhängende Prozesse zu bringen.
Und was für die Ausstrahlung dieser mathematischen Modellierungen vielleicht noch wichtiger ist: Sie sind durchaus nicht auf die Biologie im engeren Sinn beschränkt, sondern treten mit dem Anspruch auf, Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, die für präbiotische Moleküle ebenso gelten wie für menschliche Massengesellschaften. Und zwar ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, je nämlich, welche die Herausbildung von kooperativem Verhalten beschreiben. Wobei der Terminus "Kooperation" notgedrungen weit gefasst ist: Die katalytische Verstärkung der Produktionsrate eines Enzyms durch ein zweites firmiert hier ebenso als Kooperation wie der Zusammenschluss von Einzellern und Formen der gegenseitigen Unterstützung in tierischen oder eben auch menschlichen Gesellschaften.
Martin Nowaks erstes populäres Buch, verfasst gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Roger Highfield, ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Mit der Entgegensetzung einer dunklen und einer lichten Seite der Biologie beginnt es. Die dunkle Seite entspringt der Anwendung eines "darwinistischen" Bildes auf unsere eigenen Angelegenheiten, womit bedingungsloser Egoismus zum naturhaften universellen Antriebsmoment aller Akteure noch in modernen Gesellschaften avanciert. Wogegen die lichte Seite mit der fraglosen Evidenz operieren kann, dass in ebendiesen Gesellschaft Kooperation selbstverständlich alle Lebensbereiche durchdringt.
Das ist eigentlich kein Widerspruch, zu dessen Auflösung es raffinierter Mathematik bedürfte: Die angeführte radikale "darwinistische" Interpretation geht an offenkundigen Formen unserer sozialen Kooperation - von kleinsten Gruppen bis zur globalen Vernetzung - eben schlicht vorbei. Wir mögen oft oder meist eigennützige Motive verfolgen, aber wir tun das offenkundig, indem wir direkt und/oder indirekt mit anderen kooperieren.
Doch zum Auftakt braucht es den darwinistischen Stachel, nach dem von Natur aus nur das Antriebsmoment des Eigennutzens gilt, als fortdauernde Erbschaft eines biologischen Regimes, das auf Optimierung der Reproduktionschancen eingestellt ist. Die Frage ist dann, wie aus diesem Regime Mechanismen der gegenseitigen Unterstützung hervorgehen. Die mathematisch formulierte Antwort führt zuletzt auf eine denkbar allgemeine Formel für die Herausbildung von Kooperation.
Der Weg dorthin sind Fortentwicklungen spieltheoretischer Modellierungen. Am Anfang stand das berühmte, zuerst 1950 formulierte "Gefangenendilemma": Die beiden "Gefangenen" müssen entscheiden, ob sie kooperieren (den Mund halten) oder defektieren (den anderen verpfeifen). Kooperieren beide, fahren sie am besten, defektiert nur einer, hat dieser einen noch größeren Vorteil und der andere dafür einen entsprechenden Nachteil, defektieren beide, fahren beide schlechter als im ersten Fall der Kooperation. Unter der im Modell gesetzten Bedingung, dass Absprachen unter ihnen ausgeschlossen sind, wählen beide jedoch vernünftigerweise ebendie Defektion, denn diese Wahl ergibt für sie den besten Erwartungswert über die möglichen Spielausgänge.
Ob irgendein biologisches System im engeren Sinn tatsächlich so organisiert ist, darüber besteht zwar keine Einigkeit. Aber der Anziehungskraft dieses spieltheoretischen Moduls hat das keinen Abbruch getan. Die Grundidee der Nowak und seine Mitarbeiter folgen: Sie lassen verschiedene Strategien auf der Skala von strikter Kooperation bis strikter Defektion in wiederholten Interaktionen vom Typ des Gefangenendilemmas in einer Population aufeinandertreffen, um dann zu sehen, welche von ihnen sich - dauerhaft oder auch nur in bestimmten Phasen zyklisch verlaufender Entwicklungen - durchsetzen.
Mit angebrachten Verfeinerungen - probabilistischen Unschärfen, Annahmen über Begegnungswahrscheinlichkeiten, nichtsimultane Entscheidungen in den Begegnungen, Einrechnung vorausgegangener direkter Interaktionen oder auch solcher mit anderen Teilnehmern (Aufbau einer Reputation) - werden daraus Nowaks fünf Spielweisen der Kooperation: Sie reichen von direkter Reziprozität ("Wie du mir, so ich dir") bis zur Gruppen- und der klassischen Verwandtenselektion.
Dass hier auch die Gruppenselektion auftaucht, also zur Herausbildung erfolgreicher kooperativer Strategien die Konkurrenz zwischen Gruppen - oder auch Gruppen von Gruppen - zählt, hat insbesondere zu heftigem Widerspruch von Evolutionsbiologen geführt. Einsprüche, die Nowak naturgemäß nicht einleuchten, schließlich sei die Mathematik tadellos. Aber so einfach scheint das nicht zu sein: Elegante Mathematik lässt sich offenbar nicht umstandslos konvertieren in die Behauptung, man hätte die ausschlaggebenden Mechanismen damit schon deutlich vor sich - in diesem Fall in die Feststellung, dass die natürliche Auslese direkt Gruppen bewerte. Für die zahlreichen Kritiker greifen die Selektionskräfte nur auf der Ebene der Individuen an, mit nachgeordneten Effekten auf höheren Organisationsebenen.
Von allen Details abgesehen, über die die Fachleute hier streiten müssen: Man gewinnt manchmal den Eindruck, dass die von Nowak vertretene Multilevel-Selektion die "natürliche Auslese" klassischen Zuschnitts in einer Weise verallgemeinert, die nicht von Mathematik begeisterten Biologen schnell merkwürdig erscheint. Was so verwunderlich nicht unbedingt ist: Denn da Nowaks Modelle von Biomolekülen, bei denen kein Verdacht auf kulturelle Beimengungen vorliegt, bis zu kulturell durchgeformten Gesellschaften gelten sollen, ist das Terrain der "natürlichen Selektion" bei ihm unbegrenzt: Alles ist bei ihm Biologie - oder wie man es nennen mag -, aber nur durch ihre Verdünnung zum spieltheoretischen Modell.
Wobei Nowak freilich diese "Verdünnung" als Vordringen zu ihrem harten, mathematisch herauspräparierten Kern ansieht. Einstweilen scheint er damit allerdings nicht auf der evolutionsbiologischen Überholspur zu sein. Gleichzeitig darf man am kulturellen Ende des Spektrums nicht unbedingt überraschende Einsichten erwarten, was freilich kein Einwand ist, vielleicht sogar im Gegenteil. Dass wir Menschen, evolutionsgeschichtlich betrachtet, Superkooperatoren sind - nicht zu verwechseln mit dem guten Willen, das zu sein -, ist freilich evident.
Auf einem anderen Blatt stehen die Ermahnungen, die Nowak und sein Mitautor im Schlusskapitel daran knüpfen: Dass die Menschheit eine nächste Stufe der "evolutionären Komplexität", also der Kooperation, erreichen muss, um diversen globalen Problemen erfolgreich zu begegnen. Das ist dann nur noch gut gemeint.
Martin A. Nowak und Roger Highfield: "Kooperative Intelligenz". Das Erfolgsgeheimnis der Evolution.
Aus dem Englischen von Enrico Heinemann. Verlag C. H. Beck, München 2013. 352 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main