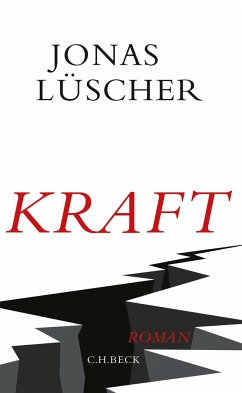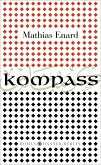Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, unglücklich verheiratet und finanziell gebeutelt, hat womöglich einen Ausweg aus seiner Misere gefunden. Sein alter Weggefährte István, Professor an der Stanford Uni versity, lädt ihn zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Preisfrage ins Silicon Valley ein. In Anlehnung an Leibniz' Antwort auf die Theodizeefrage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Für die beste Antwort ist eine Million Dollar ausgelobt. Damit könnte Kraft sich von seiner anspruchsvollen Frau endlich freikaufen ...
Komisch, furios und böse erzählt Jonas Lüscher in diesem klugen Roman von einem Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, und einer zu jedem Tabubruch bereiten Machtelite, die scheinbar nichts und niemand aufhalten kann.
Komisch, furios und böse erzählt Jonas Lüscher in diesem klugen Roman von einem Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, und einer zu jedem Tabubruch bereiten Machtelite, die scheinbar nichts und niemand aufhalten kann.

Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher will mit seinem Roman "Kraft" genau das beweisen. Gelingt es ihm?
Dieser Roman ist ein Befreiungsschlag. Er ist das Resultat eines langen zähen Kampfes mit dem erkenntnistheoretischen Hegemonialanspruch der Wissenschaft. Das Eingeständnis einer Niederlage, durchaus auch ein Dokument des Scheiterns und doch gleichzeitig und vor allem ein geglückter Ausbruch aus den Gefängnismauern der Dogmatik, ein Triumph der freien Erzählung über die streng abgesicherten Tastversuche der kritischen Analyse.
Ursprünglich wollte Jonas Lüscher eine Dissertation schreiben über die Frage, wie sich mit Hilfe von Literatur komplexe soziale Probleme beschreiben lassen. Am Lehrstuhl für Philosophie bei Michael Hampe in Zürich hatte er ein Stipendium bekommen und an der Beweisführung seiner zentralen These gearbeitet: der literarische Blick auf die Welt ist der wissenschaftlichen Sichtweise überlegen. Drei Jahre lang forschte er, suchte nach Referenzen und Theorieansätzen, ging auf Tagungen, las die Schriften des Philosophen Odo Marquard und flog nach Stanford, um das Ganze mit dem dort lehrenden Hans Ulrich Gumbrecht zu besprechen. Aber statt an einem weiteren "Werkstattbericht" zu arbeiten, streifte er durch das Silicon Valley und besuchte ein Seminar über Hiob. Und langsam, sehr langsam begann er zu begreifen, dass kein Mensch und kein Theorie-Gott ihm bei der Untermauerung seiner These helfen würde, sondern er selbst den Beweis führen müsste, indem er praktisch das tat, was er theoretisch zu belegen suchte: Einen Roman schreiben, in dem die Komplexität der Welt besser eingefangen wird als in den tausend Fußnoten einer wissenschaftlichen Abhandlung. Das war der hochgelegene Ausgangspunkt von Lüschers Unternehmung. Die Luft war dabei von Anfang an dünn und der Aufstieg steil, deshalb gab er seinem Buch und Protagonisten einen autosuggestiven Namen: "Kraft".
Richard Kraft ist ein renommierter Rhetorikprofessor in Tübingen auf dem Lehrstuhl von Walter Jens. Seine Ehe ist unglücklich, aber sein Geld zu knapp, um eine weitere Scheidung zu finanzieren. Die Ausschreibung einer hochdotierten Preisfrage, die ihm Ivan - ein alter Studienfreund - weiterleitet, bietet da eine unerwartete Fluchtmöglichkeit. Aus Anlass des 307. Jahrestages eines Leibniz-Essays zur Theodizee stellt ein verrückter Silicon-Valley-Investor eine Million Dollar für denjenigen Forscher in Aussicht, der in einem achtzehnminütigen Kurzvortrag in Stanford am überzeugendsten auf die Frage antwortet: "Warum alles, was ist, gut ist und wir es trotzdem verbessern können?"
Kraft fliegt also nach Amerika, setzt sich im Lesesaal des Hoover Towers einem Rumsfeldporträt gegenüber und beginnt nach einer überzeugenden Argumentationsstrategie zu suchen, um das Übel der Welt schönzureden. Aber so sehr er sich auch um Konzentration bemüht, immer wieder drängen sich die Erinnerungen an sein eigenes Leben dazwischen, in dem bisher eigentlich nichts gutgegangen ist und das wie eine große, hämische Antithese über seiner geplanten Theoriebildung schwebt.
Weder im Politischen noch im Privaten haben nämlich Krafts Verbindungen gehalten: Die Hinwendung zum Thatcherismus, die er als arroganter Jungakademiker aus Distinktionsgier behauptet hatte, seine wirtschaftsliberale Überzeugung und Bewunderung für starke Männer hat sich mit der Zeit ebenso abgenutzt wie die Beziehungen zu den Frauen an seiner Seite. Auf die hat er meist so lange eingeschwafelt, bis sie Kinder mit ihm zeugten, die ihm dann allerdings schnell egal wurden. Ebenso wie seine Freundschaften.
Mit Ivan, bei dem Kraft jetzt in Stanford unterkommt, hatte er in den achtziger Jahren in einer West-Berliner Wohngemeinschaft gelebt. Als Provokationsduo waren sie in den Hörsälen der Freien Universität und auf der Zuschauertribüne des Bonner Parlaments aufgetreten, hatten Reagan zugejubelt und "Kommunistenweibern" den Kampf angesagt. Eine von ihnen hatte Ivan - der sich als ungarischer Dissident ausgab, in Wahrheit aber nur zufällig von seiner Schachmannschaft in einem Berliner Hotel vergessen worden war - im Juni 1982 mit einer Gerbera so heftig ins Gesicht geschlagen, dass sein halbes Augenlicht dran glauben musste. Ein misslicher Zwischenfall, der Kraft aber nicht davon abhielt, mit der temperamentvollen Kunststudentin ins Bett zu gehen. Loyalität war für ihn schon immer nur ein theoretischer Wert. Als am Abend des Mauerfalls sein bis dahin unbekannter sechsjähriger Sohn auftaucht und Ivan auf diese Weise vom Betrug erfährt, bleibt immer noch Zeit für einen geschichtsphilosophischen Grundsatz: "Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, als finde dieses Jahrzehnt sein Ende nicht; aus der Vergangenheit drang eine Kraft in dieses Dreieck und wollte die Körper weit auseinandertreiben, aber es gab kein Entkommen."
Es ist ein Leben voller Flüchtigkeitsfehler, auf das Kraft ohne Rührung oder Reue zurückblickt. Mit einer Cola Light in der Hand und einer Polemik gegen Slavoj Zizek auf den Lippen lässt sich das Ganze bis auf weiteres ertragen. Erst ganz am Schluss verliert Kraft sein Selbstbewusstsein und stürzt in die Tiefe.
Eine der Besonderheiten dieses dramaturgisch so außergewöhnlich präzise gearbeiteten Buches ist die Erzählhaltung. Lüscher hat einen ganz eigenen Ton der distanzierten Nähe gefunden, der sich nicht plakativ an seine Figuren ranschmeißt und doch eine dichte Beschreibung von ihnen liefert. Obwohl auf jeder Seite von Kraft die Rede ist, erfährt man von seiner Persönlichkeit im Grunde recht wenig. Und was man erfährt - dass er ohne Vater aufwuchs, ein manischer Schwafler ist, einer der sich selbst gefallen möchte und dem seine Kinder und Frauen egal sind -, nimmt einen nicht gerade für ihn ein. Trotzdem ist man auf den letzten, sehr traurigen Seiten dann doch sein Verbündeter geworden und hat den Impuls, ihn gegen den Erzähler, der sich immer wieder gegen seine Hauptfigur wendet, sich über ihn mokiert und ihm Ratschläge "zurufen" möchte, in Schutz zu nehmen.
Gekonnt springt Lüscher auch zwischen den Schauplätzen hin und her, ohne dass man je den Anschluss verlöre. Eben noch ein David-Hasselhoff-Konzert auf der Berliner Mauer, jetzt ein Barbesuch im Financial District von San Francisco - die Orte und Zeiten wechseln rasant, aber der Ton bleibt immer gleich und zieht einen mit seiner unaufgeregten Hochgeschwindigkeit in den Erzählstrom hinein.
Und dann staunt man auch immer wieder über besonders gelungene Szenen: Etwa wenn Kraft, ein Skeptiker des digitalen Fortschritts ("Weder für das Verfassen der Odyssee noch von Eschenbachs Parzival oder gar Hölderlins Hyperion, so argumentiert Kraft gerne, habe es einen Computer gebraucht"), nach einem Kanubootunfall nackt, mit aufgeschlagenen Knien vor den funkelnden Türmen des Silicon Valleys steht und vom "Motor des Fortschritts" niedergerungen wird. Oder wie der junge Kraft im Bonner Plenarsaal nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt den Söhnen von Helmut Kohl gegenübersitzt, die nicht klatschen, sondern nur leise und ungläubig den Kopf schütteln: "Kraft hatte die Befürchtung, die gesamte Familie Kohl habe dem Patriarchen im Augenblick seines größten Triumphes die charakterliche Eignung für das eben erreichte Amt abgesprochen." In Lüschers Buch geht es ständig zwischen bundesdeutscher Historienfiktion und amerikanischer Gegenwartsdystopie hin und her, laufen Ansätze eines Wenderomans in Anfänge einer Milleniumsfarce über. Zusammengehalten wird alles von einer lakonischen Melancholie über das Ende einer alten und den Beginn einer neuen Zeit.
"Kraft" ist aber auch und vor allem ein Buch über den Wissenschaftsbetrieb und seine absurden Ausformungen. Der vorauseilende Gehorsam einer statussüchtigen Forschergeneration, die immer gerade dahin forscht, wo sie das meiste Geld vermutet, wird darin ebenso aufs Korn genommen wie die Webtechnik persifliert, mit der hier schamlos Theorieversatzstücke zusammengewoben werden, als handele es sich bei Wissenschaft um einen Handarbeitskurs im regionalen Kulturzentrum: "Für die Anschlussfähigkeit ein roter Faden vom späten Heidegger, Nietzsche oder Schopenhauer, dann zur Abgrenzung ein paar Randmaschen aus der dichten Unterwolle Huntingtons, aus dem Querfaden heraus ein paar rechte Maschen eines obskuren, vermutlich zu Recht in Vergessenheit geratenen chilenischen Ökonomen aus der Chicagoer Schule, eine halbe Nadellänge Finkelkraut für die Empörung, eine halbe Nadellänge Hölderlin fürs Gemüt und zur ironischen Imprägnierung, aber auch als vorsorglich offen gehaltener Fluchtweg, ein paar Maschen Karl Kraus."
Lüscher ironisiert nicht leichtfertig, nicht überheblich. Dafür hat er sich zu intensiv mit dem beschäftigt, was er hier in seiner ganzen hoffnungslosen Verirrung vorführt. Er zeigt viel eher, wie sehr der Geisteswissenschaft ihr Ethos abhandengekommen ist, wie sie sich darauf verlässt, dass die Welt mit mathematischen Modellen angemessen beschrieben werden kann und sich so selbst all ihrer narrativen Kraft beraubt. Manche werden Lüscher vorhalten, dass sein Roman nur das persönliche Scheitern an den Anforderungen der Wissenschaft überspiele, dass er die Erzählung heroisiere, weil ihm für die kritische Theorie die Geduld nicht reichte. Sollen sie nur! Sollen sie weiter nach strategischen Erklärungen suchen, wo er schon dichte Beschreibungen gefunden hat. Bilder, Szenen, Dialoge, die viel wissen lassen von dem, worum es in der Welt geht.
Jonas Lüscher, der 2013 mit "Frühling der Barbaren", einer Novelle über den Irrsinn der Finanzkrise, erstmals Beachtung fand, hat für seinen ersten Roman den richtigen Titel gewählt: Kraft ist nicht nur der Name der Hauptfigur, sondern auch das Wesen seiner Erkenntnis: Die Kraft der Erzählung gegenüber der Schwäche von Wissenschaft, die hat er mit diesem Buch jedenfalls eindrücklich bewiesen.
SIMON STRAUSS
Jonas Lüscher: "Kraft". Roman. C. H. Beck, 237 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Jonas Lüscher erzählt mit Furor, Sinn für Komik und düsterer Wucht (...) Er zeigt, wie eindringlich Literatur sein kann."
Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 24. September 2017
"Neben seiner Klugheit ist 'Kraft' auch noch ein überaus witziges Buch."
Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 23. September 2017
"Lüscher's sense of humour and willingness to poke fun at his characters combined with his skill as a writer make this novel that is both intellectually challenging and a pleasure to read."
New Books in German Nr. 41.1, 2017
"Das Buch der Stunde, das Buch zu unserer Zeit."
Dina Netz, Deutschlandfunk, 07. März 2017
"Ein großer Wurf mit philosophischen Exkursen und umwerfend komischen Szenen."
Karin Großmann, Sächsische Zeitung, 11. Februar 2017
"Eine kühl-heitere Gelehrtensatire mit Zeitgeistkritik."
Welt am Sonntag kompakt, 12. Februar 2017
"Jonas Lüschers fulminantes Romandebüt 'Kraft' erzählt vom Clash zwischen Old Europe und New Economy [...] Die kühle Intellektualität dieses Autors ist ein schöner Fremdkörper in einer Zeit, in der Reflexionsprosa nicht allzu hoch im Kurs steht."
Süddeutsche Zeitung, 04. Februar 2017
"Ein ironisch gebrochener intellektueller Diskurs und eine spannende, sinnliche Geschichte."
Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 4. Februar 2017 Platz 1 der SWR-Bestenliste Februar 2017
"Jonas Lüschers neuer Roman 'Kraft' gehört zum Besten, was die Schweizer Literatur seit Jahren zu bieten hat."
Peter Bruni, Basler Zeitung, 31. Januar 2017
"Eine Geschichte über einen Mann und eine Million Dollar, die einen gleich mit Haut und Haar ergreift und regelrecht hineinsaugt in die existentielle Bredouille unseres Helden."
Denis Scheck, Das Erste "druckfrisch", 29. Januar 2017
"Es ist die Mischung aus Pfeifenraucherjargon und vor fast nichts zurückschreckender Ironie, die 'Kraft' zu einem jener Bücher macht, nach dessen Lektüre man intuitiv nach Platz sucht im Regal, nicht nur für dieses, sondern auch für alle anderen, die von Lüscher noch kommen."
Sebastian Hammelehle, LiteraturSPIEGEL, 28. Januar 2017
"Bilder, Szenen, Dialoge, die viel wissen lassen von dem, worum es in der Welt geht."
Simon Strauss, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 29. Januar 2017
"Ein aufregender, komischer und vor allem hoch politischer Roman (...) Ein Glücksfall."
Heide Soltau, NDR Kultur, 26. Januar 2017
"Lüscher erweist sich auch in diesem Roman als außergewöhnlich präziser Beobachter, der mehrschichtig ein Psychogramm mit der Zeitgeschichte und dem Zeitgeist verbindet."
Hansruedi Kugler, St. Galler Tagblatt, 26. Januar 2017
"Nach 'Frühling der Barbaren' hat man Großes von Jonas Lüschers erstem Roman erwartet. Er liefert es."
Martin Ebel, Der Bund, 27. Januar 2017
"Ein hochintelligenter Lesegenuss, der an vielen Stellen sogar saukomische Wendungen bereithält."
Holger Ehling, Buchkultur, Februar/März 2017
"Dieses Buch wird für Furore sorgen."
Anne-Sophie Scholl, Berner Zeitung, 22. Januar 2017
"Lüscher is a perceptive commentator on Silicon Valley's heady and hubristic ideological climate, with its smug boasts of 'disruption' and death-denying (or rather 'posthuman transtheotechnist') longings."
The New York Times, Rob Doyle
Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 24. September 2017
"Neben seiner Klugheit ist 'Kraft' auch noch ein überaus witziges Buch."
Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 23. September 2017
"Lüscher's sense of humour and willingness to poke fun at his characters combined with his skill as a writer make this novel that is both intellectually challenging and a pleasure to read."
New Books in German Nr. 41.1, 2017
"Das Buch der Stunde, das Buch zu unserer Zeit."
Dina Netz, Deutschlandfunk, 07. März 2017
"Ein großer Wurf mit philosophischen Exkursen und umwerfend komischen Szenen."
Karin Großmann, Sächsische Zeitung, 11. Februar 2017
"Eine kühl-heitere Gelehrtensatire mit Zeitgeistkritik."
Welt am Sonntag kompakt, 12. Februar 2017
"Jonas Lüschers fulminantes Romandebüt 'Kraft' erzählt vom Clash zwischen Old Europe und New Economy [...] Die kühle Intellektualität dieses Autors ist ein schöner Fremdkörper in einer Zeit, in der Reflexionsprosa nicht allzu hoch im Kurs steht."
Süddeutsche Zeitung, 04. Februar 2017
"Ein ironisch gebrochener intellektueller Diskurs und eine spannende, sinnliche Geschichte."
Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 4. Februar 2017 Platz 1 der SWR-Bestenliste Februar 2017
"Jonas Lüschers neuer Roman 'Kraft' gehört zum Besten, was die Schweizer Literatur seit Jahren zu bieten hat."
Peter Bruni, Basler Zeitung, 31. Januar 2017
"Eine Geschichte über einen Mann und eine Million Dollar, die einen gleich mit Haut und Haar ergreift und regelrecht hineinsaugt in die existentielle Bredouille unseres Helden."
Denis Scheck, Das Erste "druckfrisch", 29. Januar 2017
"Es ist die Mischung aus Pfeifenraucherjargon und vor fast nichts zurückschreckender Ironie, die 'Kraft' zu einem jener Bücher macht, nach dessen Lektüre man intuitiv nach Platz sucht im Regal, nicht nur für dieses, sondern auch für alle anderen, die von Lüscher noch kommen."
Sebastian Hammelehle, LiteraturSPIEGEL, 28. Januar 2017
"Bilder, Szenen, Dialoge, die viel wissen lassen von dem, worum es in der Welt geht."
Simon Strauss, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 29. Januar 2017
"Ein aufregender, komischer und vor allem hoch politischer Roman (...) Ein Glücksfall."
Heide Soltau, NDR Kultur, 26. Januar 2017
"Lüscher erweist sich auch in diesem Roman als außergewöhnlich präziser Beobachter, der mehrschichtig ein Psychogramm mit der Zeitgeschichte und dem Zeitgeist verbindet."
Hansruedi Kugler, St. Galler Tagblatt, 26. Januar 2017
"Nach 'Frühling der Barbaren' hat man Großes von Jonas Lüschers erstem Roman erwartet. Er liefert es."
Martin Ebel, Der Bund, 27. Januar 2017
"Ein hochintelligenter Lesegenuss, der an vielen Stellen sogar saukomische Wendungen bereithält."
Holger Ehling, Buchkultur, Februar/März 2017
"Dieses Buch wird für Furore sorgen."
Anne-Sophie Scholl, Berner Zeitung, 22. Januar 2017
"Lüscher is a perceptive commentator on Silicon Valley's heady and hubristic ideological climate, with its smug boasts of 'disruption' and death-denying (or rather 'posthuman transtheotechnist') longings."
The New York Times, Rob Doyle