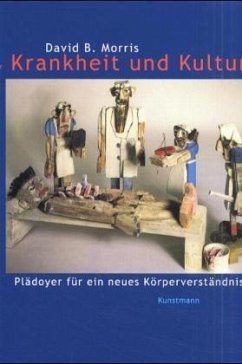Produktdetails
- Verlag: Verlag Antje Kunstmann
- Originaltitel: Illness and Culture in the Postmodern Age
- Seitenzahl: 391
- Abmessung: 34mm x 143mm x 215mm
- Gewicht: 610g
- ISBN-13: 9783888972515
- ISBN-10: 3888972515
- Artikelnr.: 08894605
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Was amerikanische Seifenopergucker weinen läßt, kann einen europäischen Landarzt nicht erschüttern / Von Gangolf Seitz
Wenn unsereiner eine Grippe bekommt, so kann ihm die Schulmedizin recht genau beschreiben, was da im Körper abläuft: von dem Virus, das sich in den Zellen eingenistet hat, über die anschwellenden Schleimhäute, die Schnupfen und Husten hervorrufen, bis hin zum Immunsystem, das mit Hilfe von Fieber versucht, dem Grippevirus den Garaus zu machen. Das ist der biomechanische Aspekt der Grippe. Zusätzlich kann man die Grippe aber auch in einem soziokulturellen Kontext betrachten und sie darauf zurückführen, daß man in der Morgendämmerung in der Straßenbahn oder bei Mondschein im Omnibus von schniefenden Mitreisenden infiziert wurde. Ohne Straßenbahn keine Grippe, ließe sich daraus vorschnell schließen; zumindest aber könnte man in Überlegungen verfallen, durch Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs die Inzidenz viraler Atemwegsinfekte zu beeinflussen.
Damit ist ungefähr umrissen, womit sich David B. Morris in seinem Buch auseinandersetzt. Krankheit im Zeitalter der Postmoderne (also in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts) sei vor allem durch die vorherrschende biomechanisch denkende Schulmedizin definiert worden. Das öffentliche Wissen um Krankheit sei geprägt durch die hektische Tätigkeit in den emergency rooms der televisionären Seifenopern, durch spektakuläre Ereignisse wie Herzverpflanzungen, durch den unbedingten Glauben an die Omnipotenz der Schulmedizin und deren tagtäglich auf den Markt geworfenen neueren, besseren Medikamente. Das Ideal von Gesundheit sei genauso bestimmt durch die muskelbepackten Jünger der Fitneß-Studios wie von der aseptischen künstlichen Welt von Disneyland. Was allerdings vernachlässigt werde, sei die Betrachtung der Krankheit im Zusammenhang mit herrschenden Gebräuchen und kulturellen Gepflogenheiten. Erst durch die Zusammenschau des biomechanischen und des biokulturellen Krankheitsbildes könne man zu einem neuen, umfassenden und besseren Verständnis von Krankheit gelangen.
Morris beleuchtet seine These von vielen Seiten, bringt säckeweise Beispiele, zitiert auf den 350 Seiten des populärwissenschaftlichen Werkes immerhin 461 Literaturstellen. Beispielhaft, aber ausführlich, betrachtet er den Umgang der Menschen mit Schmerz, mit Tod, mit bestimmten Leiden wie Aids, Schlaganfall oder Infektionskrankheiten und findet immer wieder seine These bestätigt, daß Krankheit zwar einen biologischen Kern habe, daß dieser aber durch die Kultur erst ausgeformt werde, daß Krankheit gleichsam an der Schnittstelle von Kultur und Biologie entstehe, ebenda, wo das Grippevirus und die Straßenbahn zusammentreffen.
Das ist ja nun alles so unbekannt nicht und schon gar nicht falsch, so daß man sich wundern muß, weshalb der Herr Morris so viele Worte zu diesem Thema verliert. Vielleicht ist es seine amerikanische Sozialisation, die ihn ein Problem da sehen läßt, wo es uns Europäern nur ansatzweise erscheint.
Der von Morris immer wieder behauptete Primat der Schulmedizin, das unbedingte Vertrauen der Menschen an die heilsame Wirkung von Medikamenten, kann so für Europa keine Geltung beanspruchen. Seit Jahren, teilweise Jahrhunderten, kennen wir auch andere Auffassungen neben der schulmedizinischen Sichtweise. Wir kennen die Homöopathie eines Samuel Hahnemann, die anthroposophische Medizin nach Rudolf Steiner, die skurril anmutende Blütentherapie eines Dr. Bach. Seit mehr als dreißig Jahren wirbt die von Cicely Saunders initiierte Hospizbewegung für einen über das Biomedizinische hinausgehenden Umgang mit Sterben und Tod. Hierüber verliert Morris aber gerade einmal fünf Zeilen.
Ein Begriff, der genau das wiedergibt, wofür Morris eintritt, nämlich die ganzheitliche Betrachtungsweise von Krankheit, ist im ganzen Buch nicht zu finden. Dabei fehlt dieser Begriff hierzulande in keinem Lehrkatalog für Mediziner und Pflegeberufe mehr, da die medizinischen Disziplinen, allen voran die Allgemeinmedizin und die Psychosomatik, wissen, wie eng die Krankheitsentstehung und -verarbeitung mit dem kulturellen Umfeld verwoben sind. Morris' Buch mit den immer wieder behaupteten strikten Gegensätzen zwischen dem biomechanischen und dem biokulturellen Modell wirkt auf den europäischen Leser seltsam fremd, die Thesen künstlich hochstilisiert. Was Morris uns als etwas revolutionär Neues anpreist, kommt einem vor wie alter Wein in neuen Schläuchen.
Morris' Belesenheit und die daraus sich ergebende ausufernde Benennung von Beispielen entführen den Leser immer wieder in durchaus interessante Nebengebiete, aber eben weg vom Thema. So hätte das ganze Kapitel über die Neurobiologie und das Obszöne im Interesse einer Straffung weggelassen werden können, hilft es doch Morris' eigentlichem Anliegen nur wenig weiter. Statt dessen muß der Leser geduldig den gedanklichen Wanderungen des Herrn Morris folgen, um sich am Schluß erneut sagen zu lassen, daß Krankheit eben nicht nur eindimensional biomechanisch, sondern in ihrer Entstehung und Verarbeitung multifaktoriell ist, und daß es gut tut, viel darüber zu reden ("narrative Bioethik").
Die Übersetzung ins Deutsche ist ordentlich gelungen, wenn auch den immerhin drei Übersetzern der Unterschied zwischen Katheter und Katheder fremd ist. Das Kopfschütteln, mit dem diese umfängliche amerikozentrische Werk den europäischen Leser zurückläßt, kann aber auch eine ordentliche Übersetzung nicht beheben. Denn eigentlich hatten wir immer schon gewußt, daß man sich eine Grippe in der Straßenbahn einfangen kann.
David B. Morris: "Krankheit und Kultur". Plädoyer für ein neues Körperverständnis. Aus dem Englischen von Barbara Steckhan, Thomas Wollermann und Bernhard Jendricke. Kunstmann Verlag, München 2000. 392 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
"Recht skeptisch" gegenüber den Versprechungen der modernen Medizin findet der Rezensent mit dem Kürzel "lx." den Autor dieses Buchs, David B. Morris. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist untersuche die Wechselwirkung zwischen dem kulturellen Umfeld und dem Körpers und der Psyche des Menschen. Wie der Rezensent mit einigen Beispielen belegt, wirft Morris einen kritischen Blick sowohl auf das, was die moderne Medizin bisher geleistet hat als auch auf ihre Zukunftspotentiale, z.B. Gentechnik.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH