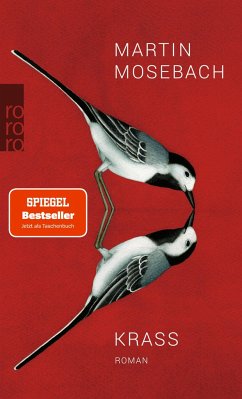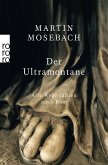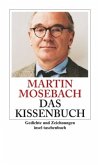Ralph Krass - so heißt ein verschwenderisch großzügiger Geschäftsmann, der Menschen mit kannibalischem Appetit verbraucht. Ist er unendlich reich oder nur ein Hochstapler, kalt berechnend, oder träumt er hemmungslos? Ein Mann, der niemals Zeit hat und in anderen Menschen nur Marionetten sieht. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt - eben noch die Assistentin eines Zauberers, eine junge Abenteurerin - und sie sich ihm widersetzt, verfällt er darauf, ihr einen ungewöhnlichen Pakt anzubieten. «Krass» ist ein atmosphärischer, bildstarker Roman über das, was das Verstreichen von Zeit mit Menschen tut, über Liebe, Verlust und magisches Wiederfinden.
Mosebach ist hier ein Werk gelungen, dem man ohne falsche Feierlichkeit das Schicksal eines unverwüstlichen Klassikers prognostizieren darf. (...) eine raffiniert durchkomponierte Meistererzählung über das Glück des Untergangs. Marianna Lieder Die Welt 20210206
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Wie Martin Mosebach in seinem neuen Roman über einen schamlosen Machtmenschen die Fäden in der Hand hält und dem Leser gekonnt Fährten auslegt, findet Rezensentin Marianna Lieder grandios. Das Zeug zum Klassiker hat das Buch ihre Meinung nach nicht nur, weil es im Text kaum Realitätsbezüge gibt, sondern auch, da Mosebach so raffiniert mit selbstparodistischen Momenten und Figurenprosa spielt und konservative Töne und Stilmerkmale gleich selbst auf die Schippe zu nehmen scheint. Erzählerisch konventionell, wie der immer wieder gehörte Vergleich des Autors mit Thomas Mann nahelegt, ist hier gleich gar nichts, versichert Lieder. Wie der Autor den auktorialen Erzähler immer wieder beliebig mit den Figuren verschmelzen lässt, scheint ihr im Gegenteil höchst originell.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Martin Mosebach und sein neuer Roman
FRANKFURT Am Anfang war das Wort. Der Name. "Er ist ganz wichtig", sagt Martin Mosebach. Zum einen besäßen nun einmal alle Menschen einen Namen, zum anderen beschwöre er für ihn die Persönlichkeit der von ihm erfundenen Figuren herauf: "Sowie der Name da ist, sind ihre Umrisse da." Krass heißt daher sprechend der Geschäftsmann, dem der Büchnerpreisträger seinen neuen Roman gewidmet hat, denn krass ist er auch in Moral, Verhalten, Vitalität, Gier, Selbstgewissheit und Selbstbetrug. "Ein großer Verdränger", sagt Mosebach in der Evangelischen Akademie am Römerberg: "Er arrangiert die Welt, so wie sie ihm gefällt." Alles andere werde hinweggefegt.
Vor wenigen Tagen ist der zwölfte Roman des 1951 in Frankfurt geborenen Autors bei Rowohlt erschienen. "Krass" ist der erste im Dutzend, der es auf die "Spiegel"-Bestsellerliste geschafft hat, von null auf Platz acht. "Für mich eine Premiere", sagt Mosebach bei der Buchvorstellung im Großen Saal der Akademie. Dort unterhält er sich mit Bernd Eilert für die "Frankfurter Premieren", die vor zehn Jahren in der Historischen Villa Metzler am Schaumainkai begannen. Während der Corona-Pandemie führt das Kulturamt seine literarische Reihe auf Youtube in Form von Aufzeichnungen fort.
Es geht um Krass, dem das Ausüben von Macht wichtig ist: "Noch wichtiger aber ist, dass er ein Phantast ist. Ein Mensch, der auf dünnem Eis wandelt und ganz und gar seinen Phantasien, seinen Träumen folgt." Auf Capri, wo Mosebach einst in der Nähe der Villa Lysis wohnte und Teile von "Westend" schrieb, besichtigt Krass eine Villa und verfällt sofort in Umbaupläne: "Eine herrscherliche Attitüde." Aber aus solchen Projekten werde nie etwas. Er sei im Grunde ein Geschäftsmann, der nichts plane außer einem: "Seine eigene Verherrlichung."
Es geht aber auch um den Angestellten Doktor Jüngel, das Gegenteil seines Bosses, "unsicher, fragil, unsouverän", der im Herbst 1988 am Golf von Neapel ungläubig faszinierte Faxe an seine Freundin sendet: "Einer, der so ist wie wir, einer, der nicht so sicher in der Welt ist." Der darüber nachdenke, ob seine Umwelt ihn liebe: "Nur eines kann er. Beobachten."
Das braucht man auch für das Verfassen von Romanen. Er habe das Schreiben bei der Arbeit gelernt, sagt Mosebach, der an diesem Abend einen Dreitagebart trägt. Wenn man analytischer veranlagt sei als er, könne man vielleicht aus dem Stand heraus sagen, was ein Roman sei: "Ich musste es ausprobieren." Herausgefunden hat er für sich seitdem Einiges. "Jede Art von Stilwollen in irgendeine Richtung länger durchzuhalten ist unerfreulich." Für Leser und Autor: "Es wurde mir klar, dass ich vergessen muss, wie ich schreibe."
Aber nicht beim Planen von Überraschungen. Zwischendurch: ein Mord. An einem Wellensittichweibchen. Durch den Gatten. "Das Böse kann auch in einem Tier wohnen", heißt es im Buch. Und das Wichtige im Nebensächlichen, ergänzt der Mosebach-Leser, dem gerade eine grundlegende Reflexion über das Rätsel der Kreatur, ihr Wollen und Handeln untergejubelt wurde. Darüber, wie man das Mitgeschöpf beobachtet und von ihm erzählt. Nach dem Tod von Krass im Jahr 2008 denkt seine ehemalige Gefährtin Lidewine daher über verpasste Chancen nach: "Wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte mit ihm." Mühe geben, das gilt im Leben und in der Kunst. Vor allem in einem Roman, der sich in zahllosen Bildern von Spiegeln und Spiegelungen vom Narzissmus des Titelhelden ab- und Objekten des Begehrens zuwendet.
FLORIAN BALKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main