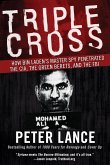Was hatten Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer und Franz Neumann mit den amerikanischen Geheimdiensten zu tun?
Anfang der 1940er Jahre nimmt eine Gruppe linksintellektueller Emigranten ihre Arbeit für den amerikanischen Kriegsgeheimdienst auf. Wissenschaftliche Aufklärung, Gegnerforschung und psychologische Kriegführung sind das Geschäft der Gelehrten im Staatsapparat. Am Anfang geht es um das nationalsozialistische Deutschland, nach Kriegsende weitet sich der Einsatz auf das gesamte Europa und die Sowjetunion aus.
Tim B. Müller gelingt eine Neudeutung der intellektuellen Architektur des Kalten Krieges, die zugleich die Politik dieser Epoche in neuem Licht erscheinen lässt. Und: Die links-intellektuelle Gruppe um Herbert Marcuse erfährt eine fundamentale Neuinterpretation, indem sie hier erstmals in ihrem historischen Kontext des frühen Kalten Krieges dargestellt wird.
Anfang der 1940er Jahre nimmt eine Gruppe linksintellektueller Emigranten ihre Arbeit für den amerikanischen Kriegsgeheimdienst auf. Wissenschaftliche Aufklärung, Gegnerforschung und psychologische Kriegführung sind das Geschäft der Gelehrten im Staatsapparat. Am Anfang geht es um das nationalsozialistische Deutschland, nach Kriegsende weitet sich der Einsatz auf das gesamte Europa und die Sowjetunion aus.
Tim B. Müller gelingt eine Neudeutung der intellektuellen Architektur des Kalten Krieges, die zugleich die Politik dieser Epoche in neuem Licht erscheinen lässt. Und: Die links-intellektuelle Gruppe um Herbert Marcuse erfährt eine fundamentale Neuinterpretation, indem sie hier erstmals in ihrem historischen Kontext des frühen Kalten Krieges dargestellt wird.

Kapitel einer transatlantischen Wissenschaftsgeschichte: Tim B. Müller geht der Frage nach, was Gelehrte im Kalten Krieg aus ihrer Arbeit für die nationale Sicherheit lernten
Wer die Überreste der intellektuellen Architektur des Kalten Krieges freilegen will, muss manche Selbst- und Fremdinszenierungen aus dem Weg räumen. Eine davon ist die Geschichte von Herbert Marcuses zehn unproduktiven Jahren im Dienste des amerikanischen Geheimdienstes.
Der deutschamerikanische Philosoph und Politologe selbst deutete die Zeit von 1942 bis 1952 als eine für sein Werk unbedeutende Episode des Broterwerbs. Der am Hamburger Institut für Sozialforschung tätige Historiker Tim B. Müller interpretiert dagegen den Dienst liberaler Gelehrter in Stiftungen und strategischen Staatsapparaten nun als Phase des Übergangs, in der entscheidende Weichen für die Entwicklung neuer wissenschaftlicher Perspektiven gestellt wurden. Im Mittelpunkt steht dabei Marcuse. Doch auch der Politikwissenschaftler Franz Neumann, der Staats- und Verfassungstheoretiker Otto Kirchheimer und der Philosoph Hans Meyerhoff haben ihren Platz in den von Müller nachgezeichneten Netzwerken des Wissens. Hinzu kommen amerikanische Gelehrte wie der Historiker Stuart Hughes und - als einziger noch lebender Protagonist - der 1915 geborene Historiker Carl Schorske.
Zunächst schildert Müller in einem weit ausgreifenden Eingangskapitel die Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes, die mit dem von 1941 an aufgebauten "Office of Strategic Services" (OSS) beginnt. Hier taten viele deutschjüdische Emigranten Dienst, in enger Zusammenarbeit mit jüngeren amerikanischen Wissenschaftlern. Um diese Gelehrtennetzwerke geht es dem Autor. Hier wurden die Grundlagen zur Beurteilung der politischen Situation erarbeitet und Pläne zu ihrer Gestaltung entwickelt: zum Umgang mit Nachkriegsdeutschland, zur Ahndung der nationalsozialistischen Kriegsverbrechen, zur Zukunft eines wirtschaftlich und politisch integrierten Europa.
Mit immensem Fleiß hat der Autor aus den archivalischen Quellen geschöpft, Akten und Korrespondenzen ausgewertet und sein reiches Material in den Zeitläuften verortet. Briefe und Vermerke, Memoranden und Länderberichte, geheimdienstliche und wissenschaftliche Texte unterschiedlichster Art lassen sich so in ihrer Bedeutung für Autoren und zeitgenössische Leser verstehen - und in ihrer historischen Wirkung.
Dabei zeigt sich, dass sich seine Protagonisten die Methoden der Geheimdienstarbeit, die Verknüpfung von interdisziplinären und transregionalen Forschungsperspektiven dauerhaft aneigneten. Die Arbeit an Strategiepapieren schärfte den Sinn für genaue regionalwissenschaftliche Analysen und Länderberichte, die den historischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Blick ebenso einbeziehen wie die Perspektive des Ökonomen und Juristen. Der genaue Blick auf den Gegner ermöglichte einen "Wandel durch Annäherung", eine Entspannungspolitik, die den Kalten Krieg vor prekären heißen Konfliktphasen bewahrte.
Müller beschreibt überschwenglich ein "Kreativzentrum der strategischen Staatsapparate", "eine Art Institute of Advanced Study jenseits des hektischen operativen Geschäfts". Auf seiner Reise durch die führenden sowjetologischen Institute Amerikas sei Marcuse der Logik der Geheimdienstforschung verpflichtet geblieben. "Seine akademische Karriere fand nicht nur auf epistemologischer Ebene im Sog der Geheimdienste statt. Marcuse, Neumann, Kirchheimer und viele ihrer amerikanischen Freunde und Kriegskameraden knüpften als Gelehrte unmittelbar an ihre Geheimdienstarbeit an. Die persönlichen Beziehungen aus dieser Zeit kamen ihnen dabei zupass."
Im Anschluss an ihre Tätigkeit im Geheimdienst fanden sich Marcuse und seine Freunde - von Müller immer wieder etwas missverständlich als "Kriegskameraden" bezeichnet - in einer neuen Konstellation, in die sich die bestehenden Netzwerke nahtlos einfügten. Es formierte sich ein "politisch-philanthropischer Komplex", in dem Forschung auf höchstem wissenschaftlichem Niveau der nationalen Sicherheit dienen sollte. Am Beispiel des von der Rockefeller Foundation geförderten Russian Institute an der New Yorker Columbia University, an dem Marcuse als "Marxist in Residence" galt, zeigt der Autor, dass die Stiftung sich auch in den Turbulenzen der McCarthy-Ära nicht von antikommunistischen Agitatoren einschüchtern ließ und an der Förderung linker Gelehrter festhielt, die wissenschaftliche Traditionen ebenso wie politische Prägungen aus den Jahren der Weimarer Republik im Gepäck hatten. Diese Gelehrten, so Müller, "operierten innerhalb eines Dispositivs der Entspannung. Die liberalen Eliten, die zu diesem Zeitpunkt die Stiftungen und die strategischen Staatsapparate dominierten, setzten auf eine Politik des Interessenausgleichs mit der Sowjetunion und warteten auf den langsamen inneren Wandel des Gegners. In diesem Zusammenhang waren Ergebnisse willkommen, die zur feineren Erfassung des Gegners und zur Begründung der Entspannungspolitik herangezogen werden konnten."
Mit der Publikation von Marcuses "Eros and Civilization" lässt Tim B. Müller diese Phase enden. Mit seinem Gegenentwurf zu einer von sozialer wie sexueller Unterdrückung beschädigten Gesellschaft wird Marcuse zum intellektuellen Stichwortgeber der studentischen Protestbewegung der sechziger Jahre. In Marcuses Fall habe das geheimdienstliche Vertrautwerden mit dem Feind womöglich auch zur Verfeindung mit dem Vertrauten geführt: "Nach einer Phase des Arrangements mit der liberalen Ordnung begann Marcuse in den sechziger Jahren, im Vertrauten, in der amerikanischen Gesellschaft, eine Nähe zu den totalitären Gesellschaften zu erkennen, die er als Deutschland- und Kommunismusanalytiker des amerikanischen Geheimdienstes erforscht hatte."
Tim B. Müller verfolgt die Spuren seiner Protagonisten weiter, bis zum Beginn des neuen Jahrtausends. Seine theoretischen Deutungen sind dabei nicht immer so überzeugend wie die eindrucksvollen Erträge seiner Archivstudien. Müller zielt auf eine "Ideengeschichte, die sich für die politischen und institutionellen Kontexte, für die materiellen und epistemologischen Bedingungen von Ideen und Intellektuellen interessiert". Das ist kein kleines Unterfangen, und der Autor macht aus seiner Ambition keinen Hehl.
In diesem Buch, flüssig und über weite Strecken spannend erzählt, werden zentrale Kapitel einer transatlantischen Wissenschaftsgeschichte der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verhandelt. Es führt seine Leser zurück in eine Zeit, in der Wissenschaft Politik machte. Auf lange Sicht bedeutsamer aber mag wohl umgekehrt der Einfluss des Politischen auf die Wissenschaft, ihre institutionellen Strukturen und ihre Akteure gewesen sein.
ALEXANDRA KEMMERER.
Tim B. Müller: "Krieger und Gelehrte". Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg.
Hamburger Edition, Hamburg 2010. 736 S., geb., 35,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine so spannende wie ambitionierte Ideen- und Wissenschaftsgeschichte legt der Autor laut Alexandra Kemmerer mit seiner Studie zum Wirken und Werden liberaler Gelehrter in den staatlichen Apparaten des Kalten Krieges vor. Was Tim B. Müller vom Hamburger Institut für Sozialforschung vor allem beherrscht, ist offenbar das Durchstöbern von Archiven. Die theoretische Deutung seiner Funde konnte Kemmerer hingegen nicht immer überzeugen. Dennoch erfährt sie viel über die Arbeit der amerikanischen Geheimdienste und die Gelehrtennetzwerke um Leute wie Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer und Hans Meyerhoff, in denen politisches Handeln, etwa der Umgang mit Nachkriegsdeutschland oder einem integrierten Europa, vorbereitet wurde. Das Verorten der Quellentexte, Briefe, Akten etc. in ihrer Zeit gelingt dem Autor laut Kemmerer in einer Weise, die dem Leser die Wirkung der Wissenschaft auf den Gang der Geschichte offenbart.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH