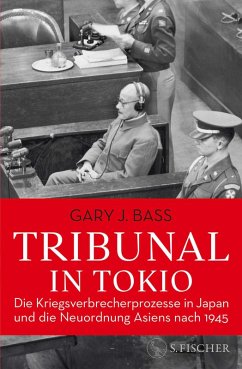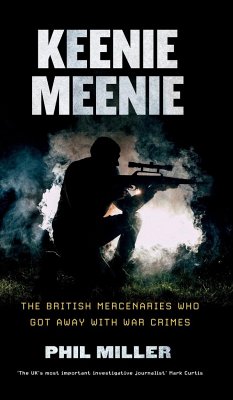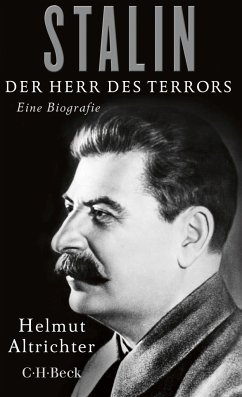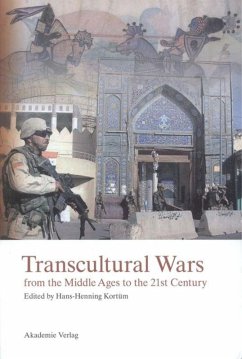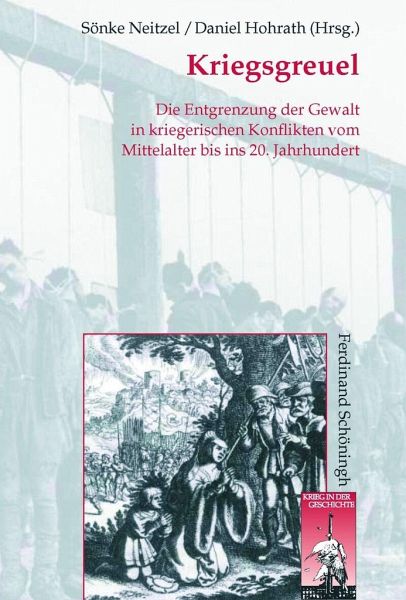
Kriegsgreuel
Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
Herausgegeben: Neitzel, Sönke; Hohrath, Daniel
Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
59,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Fast alle Gesellschaften haben sich bemüht, der organisierten Gewalt in Kriegen Grenzen zu setzen. Seitdem es Regeln für die Kriegführung gab, sind diese aber auch immer wieder gebrochen worden. Dabei kam es zu ungezählten Gewalttaten an meist Wehrlosen, die in das Kampfgeschehen im Frontbereich oder im Hinterland verwickelt waren. Der vorliegende Band befasst sich mit den von Kriegsbrauch oder Völkerrecht vorgegebenen Regeln für den Umgang mit feindlichen Soldaten und Zivilisten und mit ihrer Verletzung. Historikerinnen und Historiker aus sechs Ländern untersuchen - epochenübergreifen...
Fast alle Gesellschaften haben sich bemüht, der organisierten Gewalt in Kriegen Grenzen zu setzen. Seitdem es Regeln für die Kriegführung gab, sind diese aber auch immer wieder gebrochen worden. Dabei kam es zu ungezählten Gewalttaten an meist Wehrlosen, die in das Kampfgeschehen im Frontbereich oder im Hinterland verwickelt waren. Der vorliegende Band befasst sich mit den von Kriegsbrauch oder Völkerrecht vorgegebenen Regeln für den Umgang mit feindlichen Soldaten und Zivilisten und mit ihrer Verletzung. Historikerinnen und Historiker aus sechs Ländern untersuchen - epochenübergreifend vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert - solche Norm- und Rechtsverletzungen. Ausgewählte Fallbeispiele machen deutlich, von wem, in welcher Form, unter welchen Umständen und aus welchem Anlass diese Grenzen jeweils überschritten wurden. Welche Taten sich von der als "normal" empfundenen Gewalt des Krieges abhoben, wird ebenso aufgezeigt wie die je nach Zeit und Umständen unterschiedliche Auffassung darüber, was denn überhaupt als "Kriegsgreuel" anzusehen sei.