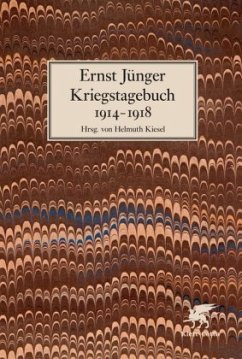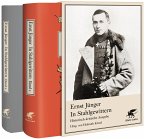Mit dieser Ausgabe sind Ernst Jüngers Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg erstmals allgemein zugänglich ein einzigartiges literarisches und zeitgeschichtliches Dokument und eine editorische Sensation!
Ernst Jüngers Frontbericht "In Stahlgewittern" ist neben Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" das berühmteste deutschsprachige Buch über den Ersten Weltkrieg. Die "Stahlgewitter" sind jedoch kein rein fiktionales Werk, sondern basieren auf den fünfzehn Tagebuchheften, die Jünger während des Krieges von der ersten Fahrt an die Front am Jahreswechsel 1914/15 bis zu seiner letzten Verwundung im August 1918 kontinuierlich führte. Der Verlauf vieler Tage wird nur in kurzen Notizen festgehalten, die Kampfeinsätze in den großen Schlachten werden hingegen erzählerisch vergegenwärtigt: Persönliches steht neben Militärischem, Empfindsames neben Martialischem, Amouröses neben Barbarischem, Anrührendes neben Abstoßendem. Und bei alledem lässt sich genauestens mitverfolgen,wiedie Erfahrungen des Krieges von Jünger psychisch verarbeitet und stufenweise literarisiert wurden.
Ernst Jüngers Frontbericht "In Stahlgewittern" ist neben Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" das berühmteste deutschsprachige Buch über den Ersten Weltkrieg. Die "Stahlgewitter" sind jedoch kein rein fiktionales Werk, sondern basieren auf den fünfzehn Tagebuchheften, die Jünger während des Krieges von der ersten Fahrt an die Front am Jahreswechsel 1914/15 bis zu seiner letzten Verwundung im August 1918 kontinuierlich führte. Der Verlauf vieler Tage wird nur in kurzen Notizen festgehalten, die Kampfeinsätze in den großen Schlachten werden hingegen erzählerisch vergegenwärtigt: Persönliches steht neben Militärischem, Empfindsames neben Martialischem, Amouröses neben Barbarischem, Anrührendes neben Abstoßendem. Und bei alledem lässt sich genauestens mitverfolgen,wiedie Erfahrungen des Krieges von Jünger psychisch verarbeitet und stufenweise literarisiert wurden.

Erstmals erscheinen Ernst Jüngers Kriegstagebücher. Darin kann man dem Autor über die Schulter schauen und verfolgen, wie zwischen Sommer 1918 und Januar 1920 aus roher ungeordneter Masse ein Stück Literatur gemacht wurde.
Von Thomas Karlauf
Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte, und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder Wein."
Das stammt nicht aus dem Editionsbericht des Herausgebers, sondern aus dem Vorwort zur fünften Auflage der "Stahlgewitter". Als Ernst Jünger 1924 über die Textgrundlage seines Erfolgsbuchs Auskunft gab und das Verfahren erläuterte, mit dem er seine Tagebuchaufzeichnungen als Infanterist an der Westfront von 1914 bis 1918 in einen "stilisierten Bericht" überführt hatte, lag das Ende des Krieges mehr als fünf Jahre zurück. Mit dem zeitlichen Abstand drohte die Erinnerung schwächer zu werden, und umso schärfer stellte sich für den Leser die Frage nach der Authentizität des Geschilderten.
Jünger trat die Flucht nach vorn an. Die von ihm oft nur flüchtig in kurzen Kampfpausen hingeworfenen Frontnotizen - "tatsächlichster Stil, einfacher Rhythmus, ohne Skrupel und Schnörkel" - ließen den "heißen Atem der Schlacht . . . stärker und unmittelbarer" spüren als die gedruckte Fassung. Weil aber für den Unbeteiligten in den Originalen zu vieles rätselhaft bleibe, habe er als Autor ordnend eingreifen, das Disparate zusammenfassen, das Angedeutete ergänzen und die größeren Zusammenhänge erläutern müssen. Nach getaner Arbeit komme ihm der Unterschied zwischen den Tagebuchaufzeichnungen und dem fertigen Text allerdings vor wie "der Unterschied von Tat und Literatur".
"In Stahlgewittern", das vielleicht kälteste Stück deutscher Prosa, nichts als Literatur, bloßer Abklatsch eines Geschehens, das sich der Beschreibung entzog? Das Gefühl der Unzulänglichkeit, die Sorge, dem Stoff nicht gerecht zu werden, war ohne Zweifel echt. "Ich bin kein Mann der Feder", hatte Jünger entschuldigend schon auf den letzten Seiten des letzten Notizhefts geschrieben, "trotzdem hoffe ich, dass mancher, der dies Buch aus der Hand legt, eine Ahnung bekommen hat von dem, was von uns Infanteristen geleistet wurde." Jünger übernahm die Formulierung ähnlich ins Vorwort der 1920 im Selbstverlag erschienenen Erstausgabe. Das Buch, so hoffe er, werde die Erinnerung wachhalten "an die herrlichste Armee, die je existiert, und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde".
Mit dem "Tagebuch eines Stoßtruppführers" traf Jünger den Nerv jener Frontkämpfergeneration, die wenige Jahre später massenhaft ins rechte Lager schwenkte. Als 1933 die bellizistische Gesinnung von 1914/18 mit der neuen Staatsideologie verschmolz, erzielten die "Stahlgewitter" Auflage über Auflage; in den folgenden zehn Jahren wurden insgesamt rund 170 000 Exemplare verkauft, und 1942 stand das Buch noch immer auf den Empfehlungslisten der Zentrale der Frontbuchhandlungen. Als man sich in den siebziger Jahren für die Vorgeschichte der Katastrophe und die ihr zugrundeliegenden Kontinuitäten des Denkens zu interessieren begann, erlangten die "Stahlgewitter" bald wieder Kultstatus. Die Interpretationen reichten von Karl Heinz Bohrers affirmativer "Ästhetik des Schreckens" bis zu den im gleichen Jahr 1978 erschienenen "Männerphantasien" Klaus Theweleits; zuletzt war es Helmut Lethen, der sich in den "Verhaltenslehren der Kälte" an einer anthropologischen Einordnung des Jünger-Typus versuchte.
Mustergültig ediert durch den Heidelberger Literaturwissenschaftler und Jünger-Biographen Helmuth Kiesel, liegen die im Deutschen Literaturarchiv Marbach aufbewahrten Kriegstagebücher jetzt in einer von Jüngers Hausverlag Klett-Cotta großzügig ausgestatteten Buchausgabe vor. Und in der Tat: Der Atem des Krieges weht einen schon beim ersten Blättern an. Wer die Eintragungen in den Notizheften und die späteren Umarbeitungen parallel lesen und Jüngers Arbeitsweise genau verfolgen will, muss zwar einige Mühe aufwenden, denn Herausgeber und Verlag haben bedauerlicherweise darauf verzichtet, eine Stellenkonkordanz beizugeben. Aber es lohnt sich. Nicht nur wegen der permanenten Übertreibungen, Verfälschungen, Beschönigungen und sonstigen Retuschen, die sich durch synoptisches Lesen leicht identifizieren lassen. Sondern vor allem, und das ist um vieles aufregender, weil man Jünger beim Arbeiten über die Schulter schauen und Satz für Satz verfolgen kann, wie zwischen Sommer 1918 und Januar 1920 aus roher ungeordneter Masse ein Stück Literatur gemacht wurde.
"Am Bahnhof Bazancourt stiegen wir aus. In der Ferne brummten die Geschütze. Wir sahen weit hinten zwei Shrapnellwölkchen, die sich in weißen Dampf auflösten." Aus diesen drei Sätzen vom 1. Januar 1915 gestaltete Jünger später den Einstieg ins Buch: "Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloss der weiße Ball eines Schrapnells im grauen Dezemberhimmel." Selten ließ sich der Schaffensprozess so genau verfolgen wie hier. Dass die Notizen ohne literarische Ambitionen abgefasst wurden - der Gedanke einer Veröffentlichung ging offenbar auf eine Anregung des Vaters im Frühjahr 1918 sowie auf die Lektüre von Goethes "Campagne in Frankreich" zurück -, verleiht der Sache einen zusätzlichen, fast möchte man sagen, jungfräulichen Reiz.
Mit der gleichen Präzision, mit der er die von ihm gefangenen Schmetterlinge beschreibt - für deren Sammlung entlang der Front er schon bald ein eigenes "Käferbuch" anlegt -, beginnt Jünger umgehend seine Beobachtungen am Menschen zu notieren: "Der erste, den ich sah, war blutüberströmt und rief ein heiseres zu Hilfe, zu Hilfe. Dem Zweiten hing das Bein lose am Schenkel . . . Einige große Blutlachen röteten die Straße und am Pfeiler klebte Hirn." Alles wird exakt notiert: die an der Stelle des Halses aus dem Rumpf herausragenden weißen Knorpel; die vielen bunten Äderchen auf einer der im Feld herumliegenden Schädeldecken; die fein nuancierten Abstufungen im Schwarz der Verwesung. Am dritten Tag an der Front stellt Jünger, dem ununterbrochenes Wachestehen und Schanzen, Kälte und Nässe in den Unterständen mehr an die Nieren gehen als der Anblick von abgerissenen Gliedmaßen, zufrieden fest: "Im allgemeinen ist mir der Krieg schrecklicher vorgekommen, wie er wirklich ist."
Bei der späteren Redaktion besonders ekeliger Szenen hat Jünger das Original abgemildert, offenbar wollte er seinen Lesern das Schlimmste ersparen. Dieser Befund ist wichtig, weil die "Stahlgewitter" immer wieder sowohl dem Vorwurf des Ästhetizismus als auch dem Vorwurf des Voyeurismus ausgesetzt waren. In den Tagebüchern hat der manische Zwang, so genau wie möglich hinzuschauen, eher therapeutische Funktion, Schreiben bewährt sich als Mittel zur Überwindung drohender Traumata: Wer den Tod so aufreizend brutal beschreibt, hält ihn sich vom Leib. "Die Zunge lag auch in der Nähe und wurde von einer Katze verzehrt."
Bei allem Snobismus kann Jünger nur schlecht kaschieren, dass die zur Schau getragene Todesverachtung am Ende - neben dem Alkohol - das stärkste Mittel ist, die Angst zu überwinden. Im Ton meist burschikos, mal wurstig, mal heroisch, bisweilen auch ziemlich pennälerhaft präsentiert der junge Soldat seine Einsichten in die Natur des Krieges am liebsten in dem später zum Markenzeichen gewordenen Jünger-Sound des souverän Beiläufigen: "Das ständige Spiel mit dem Leben als Einsatz hat einen hohen Reiz", heißt es dann, oder an anderer Stelle: "Die Gleichgültigkeit dem Tode gegenüber ist klotzig."
Mit einem Gedicht an die Mutter eröffnete Jünger im Januar 1916 das vierte Heft: "Hier wirst Du lesen, wie ich mich geschlagen, / Und wenn ich fiel, dass es in Ehren war." Kurz zuvor war er zum Leutnant befördert worden, im März 1916 feierte er seinen 21. Geburtstag, einen Monat später erhielt er seinen ersten Orden, das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse. Aber noch gab es wenig Feindberührung, noch hatte Jünger keine richtige Schlacht mitgemacht. Um dem Horror der Langeweile zu entgehen und sich auszuzeichnen, meldete er sich zu nächtlichen Patrouillengängen, auf denen er hoffen konnte, ein paar Engländer zu erwischen. "In solchen Augenblicken geht der Atem stoßweise. Alle Sinne sind aufs Höchste gespannt, man fühlt gleicherweise das Fieber des Waidmanns und die Aufregung des Wildes."
Als man das Füsilierregiment 73 in der zweiten Hälfte des Augusts 1916 ins Zentrum der Somme-Schlacht verlegt und erstmals Stahlhelme ausgegeben werden, ist Jünger dann doch ein wenig mulmig zumute - "beklommen träumerisch", nennt er seinen Zustand, "so recht: Vorabend der Schlacht". Zwei Wochen später ist seine Kompanie fast vollständig aufgerieben; er selbst wird zum zweiten Mal verwundet, überlebt, kommt ins Lazarett, erhält vierzehn Tage Heimaturlaub und steht Ende Oktober wieder an der Front. Neue Einsätze, neue Verwundungen (nach der sechsten wird ihm das Verwundetenabzeichen in Gold verliehen), neue Orden - ganz zum Schluss der Pour le mérite. "Wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende? . . . Die Sache wird höllisch monoton." Auch solche Eintragungen finden sich in den Tagebüchern, anders als später in den "Stahlgewittern", in denen nicht nur sämtliche Spuren der Angst, zahlreiche Zusammenstöße mit Vorgesetzten und die amourösen Passagen getilgt wurden, sondern eben auch kritische Reflexionen und humanitäre Anwandlungen - oder das, was Jünger dafür hielt: "Wachstubenphilosophie!"
Als die Deutschen am Morgen des 21. März 1918 mit drei Armeen auf einer Breite von achtzig Kilometern südlich von Cambrai ihre letzte große Frühjahrsoffensive eröffnen und bis auf drei Tagesmärsche an Paris herankommen, steht Jüngers Regiment wieder mittendrin. Noch einmal verlieren die Deutschen fünfhunderttausend Mann, und noch einmal gehört Jünger zu den wenigen Überlebenden seiner Kompanie. In den "Stahlgewittern" hat er seine Erlebnisse während der Operation "Michael" unter der Überschrift "Die große Schlacht" in klinische Prosa übersetzt. Die Eintragungen im Original aber zeugen von einer so "irrsinnigen Wut", dass der Verdacht naheliegt, Jünger, fortgerissen vom Furor der Vernichtung, habe die Grenze des Wahnsinns überschritten.
"3 Minuten vor dem Antreten ließ ich mir von Vinke die Flasche geben und nahm einen langen Zug Schnaps. Dann stellte ich mich hin und steckte die Offensivzigarre an." Jünger springt wie immer als Erster aus dem Graben, die Pistole in der Rechten, den Reitstock in der Linken: ",Kinder nun zeigt mal, was die 7. Kompanie kann!' Wütend schritt ich voran . . . Mir war unglaublich warm geworden. Ich riss meinen Mantel ab, einige Leute halfen mir, wieder umzuschnallen. Ich weiß noch, dass ich einige Male sehr energisch rief: ,Jetzt zieht Leutnant Jünger seinen Mantel aus' und die Leute dazu lachten."
Jeder Erfolg, wird es später in den "Stahlgewittern" heißen, entspringt der Tat eines Einzelnen. So gesehen, wäre das Töten um des Tötens willen nichts als die auf die Spitze getriebene Individualität, der Blutrausch die äußerste Anstrengung des unbekannten Soldaten im Kampf gegen sein bloßes Verglühen in der Materialschlacht. "Erst an der Gewalt der Materie hat sich uns die Gewalt der Idee offenbart", schrieb Jünger im Vorwort von 1920 und frisierte seine Tagebücher entsprechend dieser Maxime. Indem er dem Einzelnen die Würde zurückzugeben suchte, hoffte er dem vier Jahre lang ertragenen unfassbaren Geschehen doch noch einen Sinn entlocken zu können. Wohl deshalb nannte André Gide die "Stahlgewitter" 1942 "das menschlichste aller Kriegsbücher".
In den jetzt veröffentlichten Originalen findet sich von dieser Menschlichkeit nichts. Sie kennen weder Hoffnung noch Trost, ihre einzige Gewissheit ist der nächste Einschlag. Am Ende hilft nicht einmal mehr der Griff zur Literatur. Nach der grauenhaften, verstörenden Lektüre der Tagebücher erweisen sich die "Stahlgewitter" nämlich endgültig als das, was sie in den Augen ihres Autors wohl von Anfang an waren: eine blasse Reproduktion der Kriegswirklichkeit, eine mehr oder weniger verunglückte Stilisierung des Unfassbaren.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Noch nie wirkte Ernst Jünger auf Steffen Martus "so banal und zugleich so merkwürdig", so "geheimnislos und zugleich so unheimlich" wie in diesem Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg. Vor allem deshalb, weil Jünger eigenem Bekunden zufolge nicht aus Interesse an Politik und Ideologie, sondern aus reiner Abenteuer- und offenbar schierer Mordlust in den Krieg gezogen sei. Höchst trivial findet der Kritiker auch Jüngers zum Ausdruck kommenden Kitzel, nach einem opferreichen Kriegstag weiterzuleben. Gegen die Realität des Massen- und Materialkrieges fantasiere Jünger tödliche Zweikämpfe, und nervt den Kritiker darüber hinaus mit großer emotionaler Kälte und Herrenreiterposen. Auch literarisch findet Steffen Martus das Werk eher unbefriedigend: "blasse Adjektive, unpassende Vergleiche, bilderarme Sprache" führen seine Mängelliste an, obwohl er auf jeder der über 600 Seiten einen unbedingten und scheinbar vergeblichen Willen zum Stil bei diesem Autor spürt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH