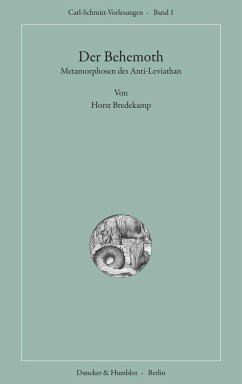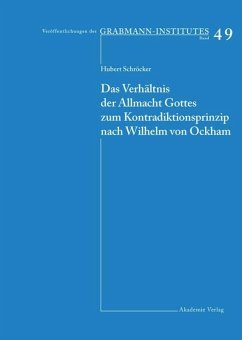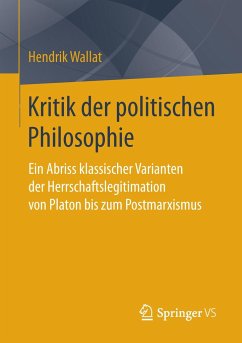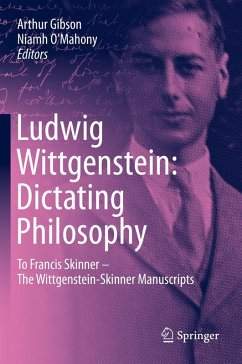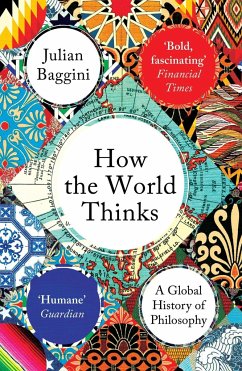Kritik der politischen Philosophie
Eine Streitschrift
Übersetzung: Wördemann, Karin
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
12,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die zeitgenössische politische Philosophie ist selbstgefällig geworden. Sie missachtet ihre eigenen Entstehungs- und Verwertungsbedingungen und verkennt so ihre Rolle im normativ umkämpften Feld des Politischen.
Geuss beschreibt, welche Aufgaben die politische Philosophie wahrnehmen muss, um in der Balance zwischen normativen Denkmodellen und der Analyse der Wirklichkeit den globalen Fragestellungen unserer Zeit angemessen begegnen zu können.
Geuss beschreibt, welche Aufgaben die politische Philosophie wahrnehmen muss, um in der Balance zwischen normativen Denkmodellen und der Analyse der Wirklichkeit den globalen Fragestellungen unserer Zeit angemessen begegnen zu können.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.